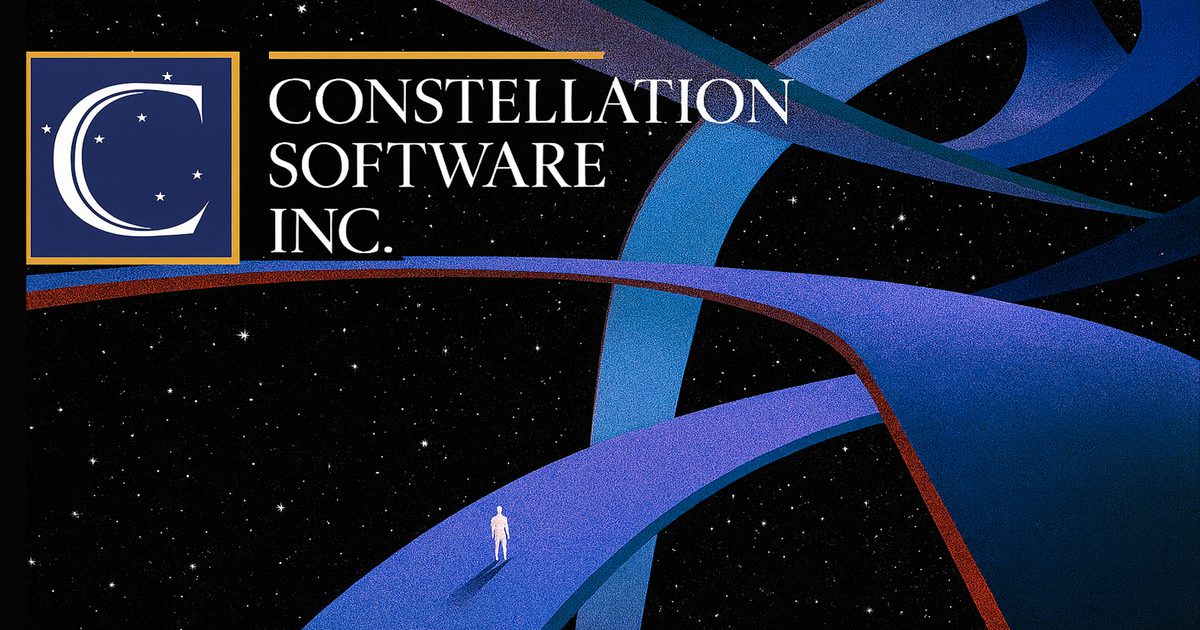Warschau sagt Nein
Es ist ein juristischer Paukenschlag mit politischem Nachhall: Das Bezirksgericht in Warschau hat entschieden, den ukrainischen Staatsbürger Wolodymyr Z. nicht an Deutschland auszuliefern. Der 46-Jährige, ein ausgebildeter Berufstaucher, steht im Verdacht, an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 beteiligt gewesen zu sein – einer der spektakulärsten Sabotageakte der europäischen Nachkriegsgeschichte.
Z. war Ende September in Polen festgenommen worden, nachdem die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hatte. Die Ermittler werfen ihm vor, gemeinsam mit einer Gruppe Sprengsätze an den Pipelines angebracht zu haben, die zwischen Russland und Deutschland verlaufen. Die Anklage lautet auf gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage.

Doch statt den Verdächtigen nach Deutschland zu überstellen, verweigerten die polnischen Richter die Auslieferung – mit Verweis auf „übergeordnete nationale Interessen“.
Die juristische Entscheidung – und ihr politisches Echo
Die Begründung des Warschauer Gerichts ist noch nicht im Detail öffentlich. Doch in Warschau ist unüberhörbar, dass die politische Dimension über der juristischen steht. Schon zuvor hatte Premierminister Donald Tusk signalisiert, dass Polen kein Interesse habe, einen ukrainischen Bürger an Deutschland auszuliefern.
Sein Satz im Oktober klang wie eine Kampfansage an Berlin:
„Das Problem Europas ist nicht, dass Nord Stream 2 gesprengt wurde – das Problem ist, dass es gebaut wurde.“
Ein Satz, der in deutschen Regierungskreisen mit Frost aufgenommen wurde. Denn er stellt die Anschläge – und deren juristische Aufarbeitung – indirekt als politisch zweitrangig dar.
Dass nur einen Tag zuvor auch Italiens Oberstes Gericht die Auslieferung eines weiteren Verdächtigen gestoppt hatte, verschärft die Lage zusätzlich. Für Berlin wird die juristische Aufklärung so zu einer politischen Zerreißprobe.
Nord Stream: das Symbol einer zerbrochenen Energieordnung
Die Explosionen im September 2022 markierten das Ende einer Ära. Drei der vier Nord-Stream-Leitungen, die einst russisches Erdgas in großem Stil nach Europa beförderten, wurden durch Sprengungen nahe der dänischen Insel Bornholm zerstört. Der Schaden war nicht nur infrastrukturell, sondern geopolitisch: Ein Symbol der europäischen Energieabhängigkeit ging buchstäblich unter.
Zum Zeitpunkt des Anschlags floss durch Nord Stream 1 bereits kein Gas mehr – Russland hatte die Lieferungen Monate zuvor eingestellt. Nord Stream 2 war nie in Betrieb gegangen, da Berlin das Projekt nach dem Angriff auf die Ukraine gestoppt hatte.
Die Anschläge befeuerten Spekulationen über Täter, Motive und Hintermänner – von russischen Geheimdiensten über ukrainische Spezialeinheiten bis hin zu westlichen Operationen. Beweise? Fehlanzeige. Der Fall blieb ein diplomatisches Minenfeld.
Zwischen Loyalität und Misstrauen
Für Polen ist die Angelegenheit mehr als ein rechtliches Verfahren. Sie ist ein Balanceakt zwischen Loyalität zur Ukraine und Misstrauen gegenüber Deutschland. Warschau versteht sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges als sicherheitspolitischer Schutzwall Europas – und betrachtet alles, was die ukrainische Kriegsführung diskreditiert, als strategisch heikel.

Der ukrainische Verdächtige Wolodymyr Z. passt in dieses Dilemma: Ein potenzieller Mitwisser eines Anschlags, der Russland politisch in die Hände spielen könnte, wenn Kiews Beteiligung nachgewiesen würde. Polen schützt damit indirekt Kiew – und nimmt diplomatische Spannungen mit Berlin in Kauf.
Ein hoher polnischer Beamter formulierte es intern laut Warschauer Medien so:
„Wir haben kein Interesse daran, Deutschland Ermittlungsakten zu liefern, die Russland freuen würden.“
Berlin steht unter Druck
In Deutschland wächst der Unmut. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hatte gehofft, den Fall endlich voranzubringen. Doch ohne Zugriff auf Zeugen und Tatverdächtige bleiben die Ermittlungen im Nebel stecken.
Bereits im vergangenen Jahr warf ein deutscher Ermittler Polen vor, die Aufklärung zu „blockieren“. Damals war Wolodymyr Z. trotz Haftbefehl in der Ukraine untergetaucht – und später über Umwege nach Polen gereist. Jetzt, da er gefasst wurde, bleibt der Zugriff erneut aus.
Hinter den Kulissen wird in Berlin über diplomatische Gegenmaßnahmen beraten. Doch der Handlungsspielraum ist eng: Polen ist Partner in der EU, NATO-Frontstaat und politisch ein zentraler Akteur im Ukrainekonflikt. Ein offener Streit über einen ukrainischen Sabotageverdächtigen wäre das letzte, was Kanzler Scholz derzeit braucht.
Europas Misstrauen wächst
Die Entscheidung aus Warschau ist mehr als ein juristisches Detail. Sie wirft ein grelles Licht auf die Bruchstellen in Europas Sicherheitsarchitektur. Während Brüssel nach außen Geschlossenheit demonstriert, wachsen im Inneren Misstrauen, Nationalinteressen und gegenseitige Schuldzuweisungen.
Polen interpretiert den Nord-Stream-Anschlag als Teil eines geopolitischen Schachzugs, nicht als klassischen Kriminalfall. Deutschland hingegen sieht sich als Opfer eines Anschlags auf seine Energieinfrastruktur – und erwartet Solidarität, nicht Schweigen.
Damit prallen zwei politische Realitäten aufeinander: Die moralische Front der Kriegsverbündeten – und die juristische Wahrheitssuche in Zeiten der Propaganda.
Eine Entscheidung mit Sprengkraft
Der Fall Wolodymyr Z. ist noch nicht zu Ende. Doch schon jetzt steht fest: Die Weigerung Polens, den Verdächtigen auszuliefern, wird zum Testfall für europäische Rechtskooperation in Kriegszeiten.
Ob es dabei um Recht, Loyalität oder politische Opportunität geht, wird sich zeigen. Sicher ist nur: Der Sprengstoff, der einst Nord Stream zerstörte, wirkt nach – diesmal in den diplomatischen Beziehungen Europas.