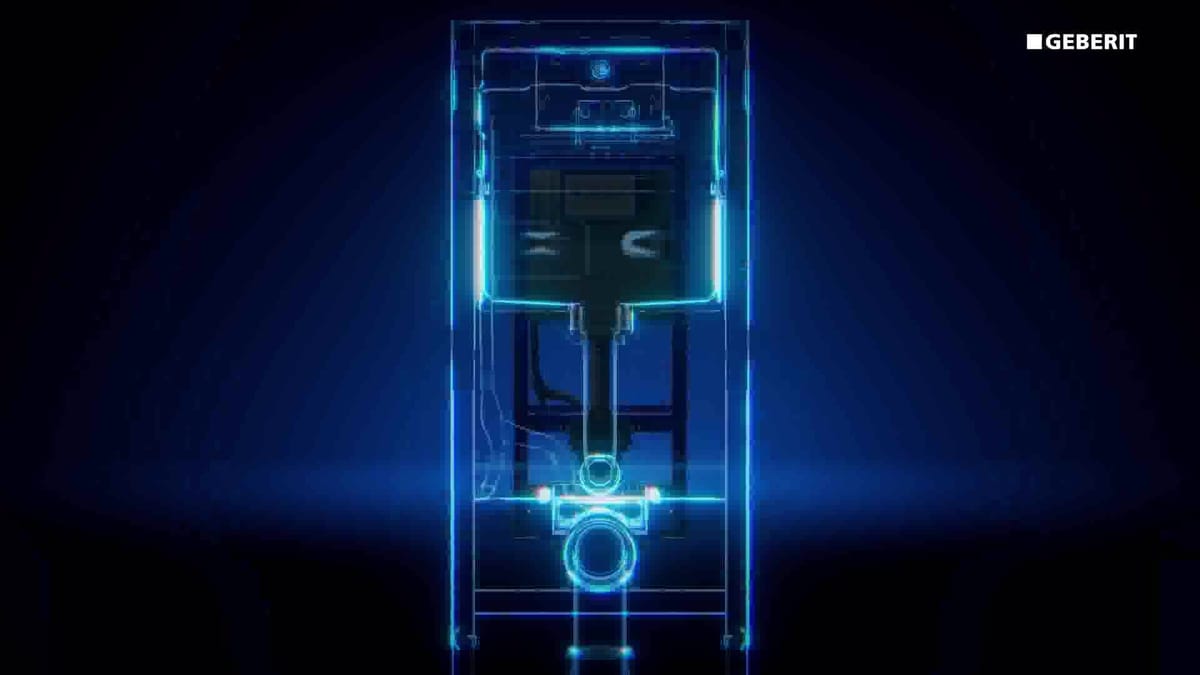Millionen für das bessere Islambild
In Brüssel ist man überzeugt: Die EU fördert keine Ideologie, sondern Exzellenz. Und dennoch sorgt eine Reihe von Forschungsprojekten zur Rolle des Islams in Europa für politische Irritationen – und für Fragen, die nicht so leicht vom Tisch zu wischen sind.
Es geht um Fördergelder in Millionenhöhe, um den Europäischen Forschungsrat, um das Projekt „The European Qur’an“ – und um die Frage, ob wissenschaftliche Objektivität in dieser Förderlogik wirklich Priorität hat.
So antwortete die EU-Kommission Anfang dieser Woche auf eine kritische Anfrage der italienischen EU-Abgeordneten Silvia Sardone (Lega), die mehrere mit EU-Mitteln geförderte Projekte zum Thema Islam und Islamophobie scharf hinterfragt hatte.
Ihre zentrale Kritik: Einige dieser Studien stellten den Islam in einseitig positivem Licht dar und suggerierten eine Islamophobie-Krise, die so in Europa nicht existiere. Ihre Anfrage richtete sich auch gegen ein Projekt zur „Entwicklung der Scharia vom offenbarten Gesetz zum Rechtssystem“ – ein Thema, das in Teilen Europas hochsensibel ist.
Die Kommission aber wiegelte ab. Alle geförderten Projekte, so heißt es in ihrer Antwort, durchliefen einen „strengen, unabhängigen Evaluationsprozess“, der wissenschaftliche Qualität und Relevanz sicherstelle. Kritiker sehen das anders.
The European Qur’an – ein Forschungstitel, der politisiert
Besonders im Fokus: das Projekt The European Qur’an. Mit über zehn Millionen Euro zählt es zu den am höchsten geförderten Vorhaben im Geisteswissenschaftsbereich.

Der Anspruch ist groß: Man wolle untersuchen, auf welchen Wegen der Koran „die christlich-europäische Kultur, Religion und Gesellschaft bereichert und inspiriert“ habe. Das klingt für viele wie der Versuch, historische Narrative umzuschreiben – zugunsten eines besseren Islambildes.
Tatsächlich sorgte die Zusammensetzung des Forscherteams für kritische Nachfragen: Wie die französische Zeitung Le Journal du Dimanche im April berichtete, soll einer der beteiligten Wissenschaftler Verbindungen zur Muslimbruderschaft unterhalten.
In ihrer Antwort geht die Kommission darauf mit keinem Wort ein – ein bemerkenswertes Schweigen angesichts der politischen Brisanz solcher Verbindungen. In vielen EU-Staaten wird die Muslimbruderschaft als islamistische, antidemokratische Bewegung beobachtet.
Islamophobie als wissenschaftliches Konzept – oder politischer Kampfbegriff?
Zweites Zankapfel-Projekt: eine mit 2,3 Millionen Euro geförderte Studie zu „Islamophobie und Islamismus im Zeitalter des Populismus“. Bereits der Titel scheint implizit eine Kausalität zu behaupten: Islamophobie ist demnach real, messbar und politisch erklärbar – und sie hängt mit dem Aufstieg des Populismus zusammen.
Für Forscher mag das eine interessante These sein, doch für politische Entscheidungsträger, die auf differenzierte Analysen angewiesen sind, stellt sich die Frage: Wo endet Wissenschaft, wo beginnt Aktivismus?
Silvia Sardone jedenfalls kritisierte, dass diese Studien „in fragwürdiger Weise die Idee befeuern, dass es einen Islamophobie-Notfall in Europa gibt“. Man könne, so ihr impliziter Vorwurf, mit viel Geld auch ein gewünschtes gesellschaftliches Narrativ erzeugen – unter dem Deckmantel der Wissenschaft.
Forschung ja – aber wie unabhängig ist die Auswahl?
Die Kommission betont, dass es keinerlei politische Einflussnahme auf die Auswahl gebe. Ein Netzwerk aus unabhängigen Gutachtern, darunter Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, bewerte die Anträge allein nach wissenschaftlicher Güte.
Die Praxis zeigt allerdings: Politisch aufgeladene Themen – etwa Migration, Religion oder Identität – erhalten überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit und Fördervolumen.
Insgesamt flossen über den Europäischen Forschungsrat bislang mehr als 30 Milliarden Euro an über 17.000 Projekte in 35 Ländern. Deutschland ist mit Abstand größter Empfänger der Fördergelder.
Auch Nicht-EU-Länder wie Israel und die Schweiz werden unterstützt. Nur ein Bruchteil der Mittel entfällt auf religionsbezogene Projekte – doch die öffentliche Wirkung dieser wenigen Projekte ist enorm.
Was bleibt: Eine Forschung, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet
Ist es Aufgabe der EU, mit Milliardenförderung eine neue Deutung europäischer Religionsgeschichte zu etablieren? Ist es gerechtfertigt, dass kritische Anfragen von Abgeordneten mit vorformulierten Standardantworten abgewehrt werden?
Und was sagt es über den Zustand der europäischen Wissenschaftsförderung, wenn ein Projekt mit potenziellen Islamismus-Nähen keinen Aufschrei, sondern einen Freifahrtschein erhält?
Die EU-Kommission steht zu ihrer Linie – und erklärt, der europäische Forschungsraum müsse auch sensiblen Themen Raum geben. Das stimmt. Aber der Raum für Kritik muss ebenso groß sein wie der für Förderung. Sonst gerät ausgerechnet das ins Wanken, was man schützen will: die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft.
Das könnte sie auch interessieren: