Berlin sagt eine Milliarde zu – und eröffnet damit erst den Konflikt
Die Bundesregierung wollte ein Signal senden: Eine Milliarde Euro stellt Deutschland dem globalen Waldschutzfonds TFFF zur Verfügung, verteilt über zehn Jahre. Ein langfristiges Versprechen, ein Beitrag zum Schutz der tropischen Regenwälder, ein sichtbares Bekenntnis zu internationaler Klimapolitik.
Doch kaum war die Zahl offiziell, begann das politische Nachspiel.
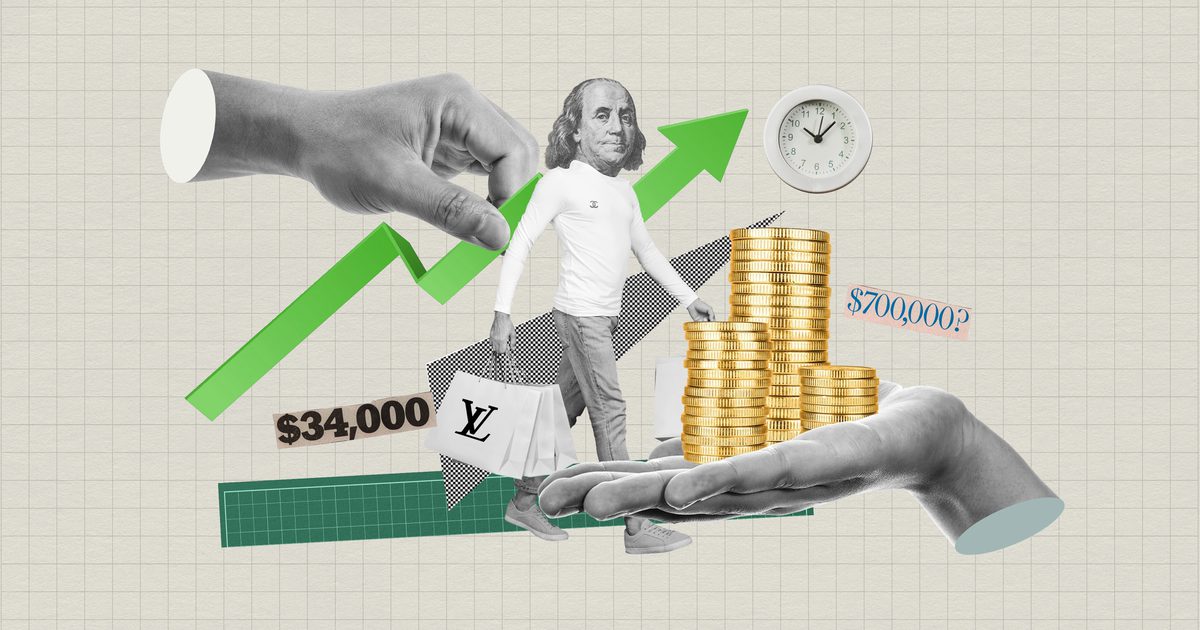
Claudia Roth, langjährige Grünen-Politikerin und ehemalige Kulturstaatsministerin, sprach von einem Betrag, der in keiner Weise dem Anspruch einer Industrienation entspreche. „Viel zu wenig“, sagte sie – und ihre Kritik zielte nicht nur auf den Betrag, sondern direkt auf den Kanzler.
Damit wurde eine Debatte eröffet, die weniger mit Regenwaldschutz zu tun hat als mit der Frage, welche Rolle Deutschland im Klimaschutz international eigentlich noch beansprucht.
Roth schießt gegen Merz – und zeichnet ein Bild der Schwäche
Roths Vorwürfe sind ungewöhnlich scharf. Der Kanzler, so ihre Darstellung, habe die deutsche Führungsrolle „preisgegeben“. Der Brasilien-Besuch von Friedrich Merz wird in ihren Worten zu einem diplomatischen Fehltritt: keine klare Botschaft, unangenehme Gesprächsatmosphäre, schnelle Abreise. Das alles schade Deutschlands Ansehen.
Ihre implizite Botschaft: Ein Land wie Deutschland könne nicht einerseits Weltmarktführer in Energie- und Umwelttechnik sein wollen und andererseits minimalistische Beträge in globale Klimafonds überweisen.
Besonders pikant: Roth verweist auf Norwegen, das „dreimal so viel“ zahlt. Ein kleineres Land – aber in der Klimafinanzierung sichtbar größer. Es ist ein Vergleich, der sitzen soll.

Die nüchterne Perspektive der Wissenschaft: Wirkung ja, aber begrenzt
Neben der politischen Schärfe meldet sich auch die Forschung zu Wort – und bringt unbequeme Proportionen ins Spiel.
Klimaforscher Mojib Latif ordnet den Effekt des Waldschutzes sachlich ein:
Landnutzungsänderungen, also Rodungen und Degradation, stehen für nur zehn Prozent der globalen Emissionen. Der Rest – rund 90 Prozent – stammt aus fossilen Brennstoffen.
Diese Zahlen machen klar: Der Wald ist wichtig, aber nicht der große Hebel. Und eine Milliarde über zehn Jahre sei, so Latif, „gar nicht so viel“. Auch das ein deutlicher Hinweis darauf, dass Deutschland sich mit dem Beitrag eher am unteren Rand der Erwartung bewegt.
Die Bundesregierung verteidigt den Fonds – aber Fragen bleiben offen
Für die Regierung ist der TFFF ein zentrales Instrument. Länder, die ihre Regenwälder tatsächlich schützen, sollen dafür auch finanziell belohnt werden. Nach Jahren ergebnisloser Waldschutzprogramme setzt Berlin nun auf Anreizmechanismen statt moralischer Appelle.

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und Umweltminister Carsten Schneider betonen deshalb die langfristige Wirkung: Nicht ein kurzfristiges Geldpaket sei entscheidend, sondern die Prinzipien und die Verlässlichkeit dahinter.
Doch ob ein langfristiger Mechanismus reicht, wenn andere Staaten deutlich mehr investieren, ist eine offene Frage. Die Kritik stellt genau diesen Punkt in den Mittelpunkt: Ist Deutschland Klimavorreiter – oder lediglich noch Mitläufer?
Hinter der Debatte steckt eine größere Frage: Wofür steht Deutschland in der Klimapolitik?
Die Auseinandersetzung über eine Milliarde Euro ist in Wahrheit eine Debatte über Anspruch und Realität.
Es geht um die Frage, ob ein hochindustrialisiertes Land mit ambitionierten Klimazielen trotzdem immer kleiner denkt.
Ob internationale Partner Deutschland noch als treibende Kraft wahrnehmen – oder als Teilnehmer, der ankündigt, aber selten führt.
Und ob man sich unter einem Kanzler Merz stärker an ökonomischer Vorsicht orientiert als an klimapolitischem Gestaltungswillen.
Claudia Roth und Mojib Latif haben dafür unterschiedliche Argumente – aber beide zielen in dieselbe Richtung: Deutschland sollte mehr tun, finanziell wie politisch.
Ein Streit, der nicht so schnell verstummen wird
Die Milliarde bleibt. Die Kritik auch.
Und die kommenden Wochen der COP30 werden zeigen, ob diese Debatte nur ein innenpolitisches Störfeuer ist – oder ob sie zu einer grundsätzlichen Frage darüber wird, wie Deutschland seine Rolle im Wettlauf gegen die Klimakrise künftig definiert.
Denn am Ende geht es nicht um die konkrete Summe.
Es geht um Glaubwürdigkeit.




