Merz attackiert Brüssel – „Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel“
Friedrich Merz war selten so deutlich. Noch vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel wetterte der Kanzler gegen das Europäische Parlament: „Diese Entscheidung ist inakzeptabel. Sie gefährdet Arbeitsplätze in ganz Europa.“ Die Ablehnung einer abgeschwächten Lieferkettenrichtlinie sei, so Merz, „eine fatale Fehlentscheidung, die korrigiert werden muss“.
Der Hintergrund: Das EU-Parlament hatte am Vortag überraschend gegen einen Kompromissvorschlag gestimmt, der die geplante Richtlinie zur Überwachung globaler Lieferketten abmildern sollte. Das Ziel des Gesetzes – der Schutz von Menschenrechten weltweit – ist unstrittig. Doch die Ausgestaltung sorgt für Zündstoff: Unternehmen warnen, dass zu strenge Haftungsregeln und niedrige Schwellenwerte sie in der globalen Konkurrenz schwächen könnten.
„Wir verlieren gerade in dramatischer Geschwindigkeit unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Merz. „Europa braucht jetzt schnelle, kluge Entscheidungen – keine ideologischen Debatten.“
Ein geplatzter Kompromiss – und viel politisches Kalkül
Besonders brisant: Der abgelehnte Vorschlag war das Ergebnis wochenlanger Verhandlungen zwischen Christdemokraten (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen (Renew). Eigentlich ein seltener Moment europäischer Einigkeit – bis zur geheimen Abstimmung. Offenbar stimmten mehrere Abgeordnete gegen die eigene Linie.
Die Folge: Der Kompromiss fiel, und das politische Vertrauen gleich mit. Aus EVP-Kreisen heißt es, einige Sozialdemokraten hätten das Abkommen „wissentlich sabotiert“. Grüne und Linke hingegen feiern die Entscheidung als „Denkzettel für die Erpressungstaktik der Konservativen“. Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini sprach vom „Super-GAU für die EVP“.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) reagierte ernüchtert. Die Chance, den Mittelstand zu entlasten, sei vertan. „Das ist ein Rückschritt für Europas industrielle Basis“, heißt es in einer Stellungnahme.
Was auf dem Spiel steht
Die Richtlinie verpflichtet Unternehmen, ihre globalen Lieferketten auf Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Umweltzerstörung zu überprüfen – und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Eigentlich ein moralisch unstrittiges Ziel. Doch Kritiker sehen in der jetzigen Fassung eine wirtschaftliche Überforderung.
Der gescheiterte Kompromiss hätte die Regelung auf Großunternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro beschränkt. Zudem wären Verstöße nicht mehr automatisch zivilrechtlich haftbar gewesen – eine entscheidende Erleichterung für viele Industriekonzerne.
Nun droht die Rückkehr zu einer härteren Fassung, die schon Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern trifft. Ein Szenario, das vor allem in Deutschland für Unruhe sorgt – der exportorientierten Industrie droht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Asien und den USA.
Europas Wirtschaftsflügel in Alarmstimmung
Merz ist nicht allein mit seiner Kritik. Auch mehrere Regierungschefs aus Nord- und Osteuropa äußerten sich besorgt. Ein EU-Diplomat sagte der InvestmentWeek: „Wenn wir überregulieren, treiben wir Produktion und Innovation außer Landes. Das ist kein Menschenrechtsschutz – das ist Selbstschwächung.“
Die wirtschaftlichen Folgen könnten beträchtlich sein. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) würde eine strenge Auslegung der Richtlinie Unternehmen in der EU jährlich mit bis zu 40 Milliarden Euro an Zusatzkosten belasten. Mittelständler warnen vor einer neuen „Bürokratie-Lawine“, die vor allem jene trifft, die ohnehin um ihre Margen kämpfen.
Der Verband der Chemischen Industrie sprach von einem „Standortrisiko made in Brussels“. Selbst Vertreter der Gewerkschaften, sonst Befürworter strenger Auflagen, fordern inzwischen eine Balance zwischen Moral und Machbarkeit.
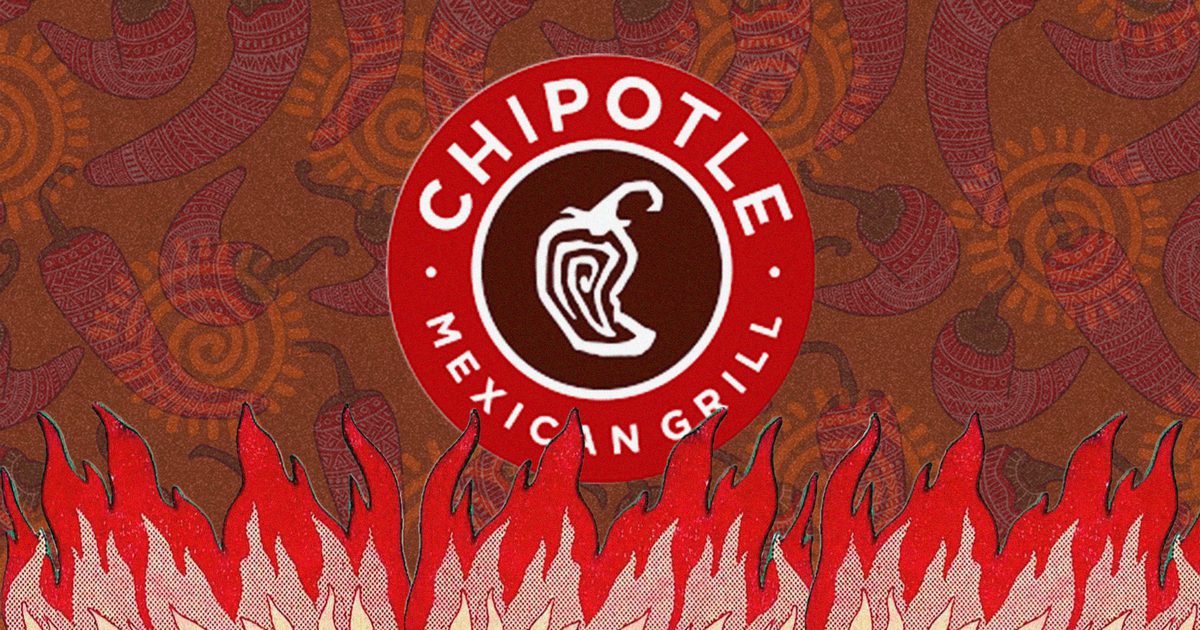
Ein politisches Eigentor?
Für Merz ist die Auseinandersetzung mehr als ein wirtschaftliches Thema. Sie wird zum Testfall seiner europapolitischen Linie. Der Kanzler, der sich seit Amtsantritt als Stimme des wirtschaftlichen Realismus versteht, sieht in der EU-Entscheidung ein Symbol für das, was viele Unternehmer längst kritisieren: zu viel Regulierung, zu wenig Pragmatismus.
Die EVP, der Merz angehört, gilt in Brüssel traditionell als Stimme der Wirtschaft. Doch der jüngste Rückschlag schwächt ihre Position – und stärkt jene Kräfte, die Brüssel für übergriffig halten. „Wenn die EU weiter an der Realität vorbei entscheidet, dann verlieren wir nicht nur Jobs, sondern auch Vertrauen“, warnt ein CDU-Europaabgeordneter.
Ein zweites Votum steht bevor
Ganz entschieden ist der Streit nicht. Im November soll das EU-Parlament erneut über die Lieferkettenrichtlinie abstimmen. Die Hoffnung der Bundesregierung: ein Rückkehr zur Vernunft. Doch der Schaden ist bereits da – und die Fronten verhärten sich.
EVP-Verhandlungsführer Jörgen Warborn kündigte an, notfalls gemeinsam mit rechtskonservativen Kräften Änderungen durchzusetzen, falls die Mitte weiter blockiere. Eine Drohung, die das politische Klima zusätzlich vergiftet.
Selbst Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die das Gesetz ursprünglich vorangetrieben hatte, steht nun vor einem Dilemma: Die Richtlinie war als Teil ihres Green Deal gedacht – jetzt droht sie, zur Belastungsprobe für die EU-Wirtschaft zu werden.
Europas Gratwanderung
Was bleibt, ist eine EU, die sich zwischen Moral und Markt bewegt – und Gefahr läuft, beides zu verlieren. Die Absicht, Menschenrechte global zu stärken, ist richtig. Doch wenn sie den wirtschaftlichen Kern Europas schwächt, untergräbt sie ihre eigene Glaubwürdigkeit.
Friedrich Merz hat mit seiner Kritik einen Nerv getroffen. Der Streit um die Lieferkettenrichtlinie ist längst mehr als ein juristisches Detail. Er ist ein Symbol für die Frage, ob Europa seine wirtschaftliche Stärke noch als strategische Ressource begreift – oder sie ideologisch verspielt.



