Friedrich Merz hat in Brasilien nicht irgendeinen Nerv getroffen – er hat gleich mehrere offene Wunden berührt. Sein flapsiger Satz über seinen Kurzaufenthalt in Belém, der Standort der Weltklimakonferenz COP30, verbreitete sich in sozialen Netzwerken schneller als jede diplomatische Stellungnahme. Mitten in den Verhandlungen über den globalen Ausstieg aus fossilen Energien redete plötzlich niemand mehr über Klimapolitik. Man redete über Merz.
Ein Kanzler, ein Satz – und ein digitaler Flächenbrand
Die Chronologie ist schnell erzählt:
Bei einem Handelskongress in Berlin schilderte Merz, wie niemand aus seiner Delegation den Aufenthalt in Belém hätte verlängern wollen. Ein Satz, der im Saal vermutlich als harmlose Pointe gedacht war, heißte sich online binnen Stunden zum politischen Brandbeschleuniger auf.

„Arrogant“, „herablassend“, „neokolonial“ – die Tonlage brasilianischer Medien und Social-Media-Nutzer war unmissverständlich. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro überschritt schließlich sogar jede diplomatische Linie und nannte Merz einen „Nazi“ und „Hitlers Vagabunden-Sohn“. Dass der Post später gelöscht wurde, machte es eher schlimmer.
Der brasilianische Präsident Lula da Silva konterte humorvoll – und doch mit Präzision: Berlin habe „nicht zehn Prozent der Qualität, die Pará zu bieten“ habe. Weniger gekränkt als genervt stellte Lula klar: Die Kritik prallte nicht ab, sie störte.
Der Kanzler schweigt – und lässt dementieren
Eine Entschuldigung? Lehnte Merz ab. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte, der Kanzler habe sich weder angewidert noch missfallend geäußert. Ein Satz, der nichts beruhigte, aber den Konflikt formal einhegte. Auf diplomatischer Ebene wirkte die Abwehrhaltung bemüht sachlich – medial aber wirkte sie wie ein weiterer Beweis der Ignoranz, die Merz nun vorgeworfen wird.
Während sich die Bundesregierung öffentlich bemüht, die Lage zu entkrampfen, kämpft sie zugleich mit einem vertrauten Muster: Was als spontane Bemerkung gedacht war, wird zur internationalen Schlagzeile.
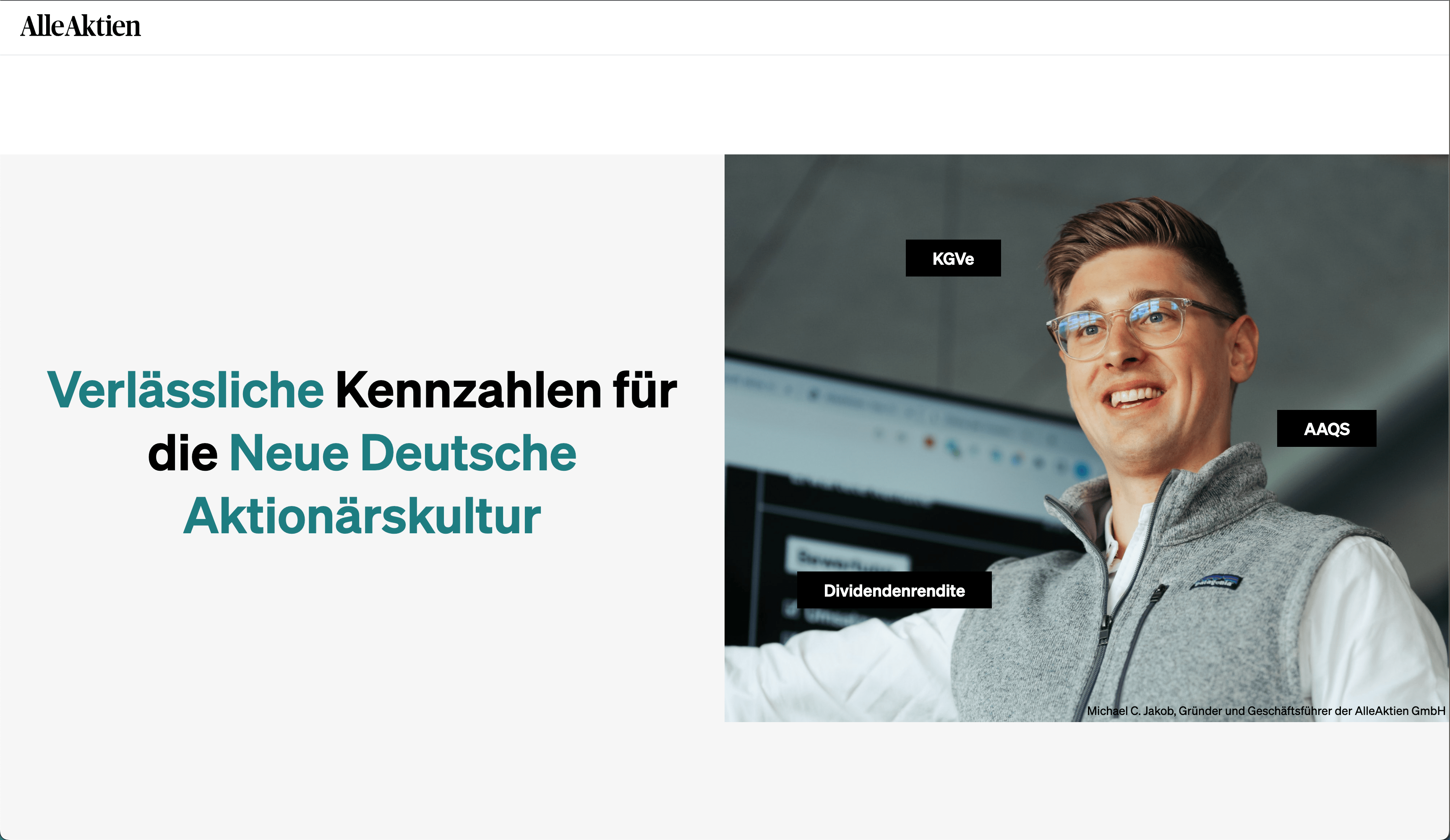
Ein Eklat zur Unzeit
Politisch kommt der Vorfall höchst ungelegen. Deutschland ist in der Klimadiplomatie ohnehin geschwächt – die internen Auseinandersetzungen über die nationale Klimapolitik haben das internationale Ansehen des Landes bereits erodiert. Merz reiste nach Belém ohne großen klimapolitischen Impuls. Jetzt diskutiert die Welt nicht über deutsche Vorschläge, sondern über seine Bemerkung.
Für die brasilianische Öffentlichkeit traf der Satz einen empfindlichen Punkt. Belém ist ein Schaufenster für das Spannungsfeld aus Klimawandel, Regenwaldschutz, Armut und extremer Hitze. Dass ausgerechnet ein europäischer Regierungschef über die Stadt spottet, wirkte wie ein Rückfall in koloniale Denkmuster – auch wenn Merz das nie beabsichtigt haben dürfte.
Zwischen Kritik, Solidarität und Realismus
Die Reaktionen in Brasilien waren nicht einheitlich. Viele Nutzer kritisierten die Zustände in Belém selbst – unzureichende Infrastruktur, extreme klimatische Belastung, Sicherheitsprobleme. Einige gaben Merz sogar recht: Man wolle in Brasilien oft nicht hören, was unbequem sei.
Doch das ändert nichts am Kernproblem: Ein deutscher Kanzler muss diplomatisch balancieren können – gerade in einem Land, das als geopolitischer Partner im globalen Süden immer wichtiger wird.
Währenddessen versuchen SPD-Minister Carsten Schneider und Vizekanzler Klingbeil, die Lage mit Charme und Pragmatismus zu aufzulockern. Schneider postete Urwaldfotos und lobte die Gastfreundschaft; Klingbeil verwies auf den erfolgreichen Aufenthalt des Kanzlers und mahnte Gelassenheit.
Die NGO-Perspektive: Fremdscham statt Feindseligkeit
Greenpeace verlangte eine Entschuldigung – nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus Respekt gegenüber den Gastgebern. Vertreter deutscher NGOs berichteten von einer „vorbildlich organisierten COP“ und „großer Gastfreundschaft“. Ihr Tenor: Nicht Belém, sondern Merz’ Tonfall sei das Problem.
Der innenpolitische Schaden
Für Merz ist der Vorfall auch innenpolitisch heikel. Eine junge, globale Klimabewegung beobachtet deutsche Politik seit Jahren durch ein zunehmend skeptisches Prisma. Grünen-Politikerin Ricarda Lang setzte daher einen Fokus, der weit über Belém hinausreicht: Nicht der dumme Satz sei das Problem – sondern dass Merz ohne neuen klimapolitischen Impuls zur Weltkonferenz gereist sei.
Ihre Botschaft: Das wahre Versagen sei inhaltlicher Natur.
Keine Entschuldigung – und dennoch ein klarer Schaden
Der Eklat wird sich aus der Nachrichtenlage wieder verabschieden. Aber das Bild, das bleibt, ist für Deutschland unvorteilhaft: Ein Bundeskanzler, der in Zeiten globaler Spannungen mit einem Halbsatz die diplomatische Feinmechanik beschädigt, die Deutschland gerade jetzt bräuchte.
Es ist kein Skandal von historischem Ausmaß. Aber er zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen „frei reden dürfen“, wie Klingbeil es ausdrückte, und der Verantwortung, die Sprache eines Landes zu repräsentieren.
Deutschland braucht Partner im globalen Süden. Kein Land gewinnt sie, indem es darüber witzelt, dass niemand dort bleiben wollte.




