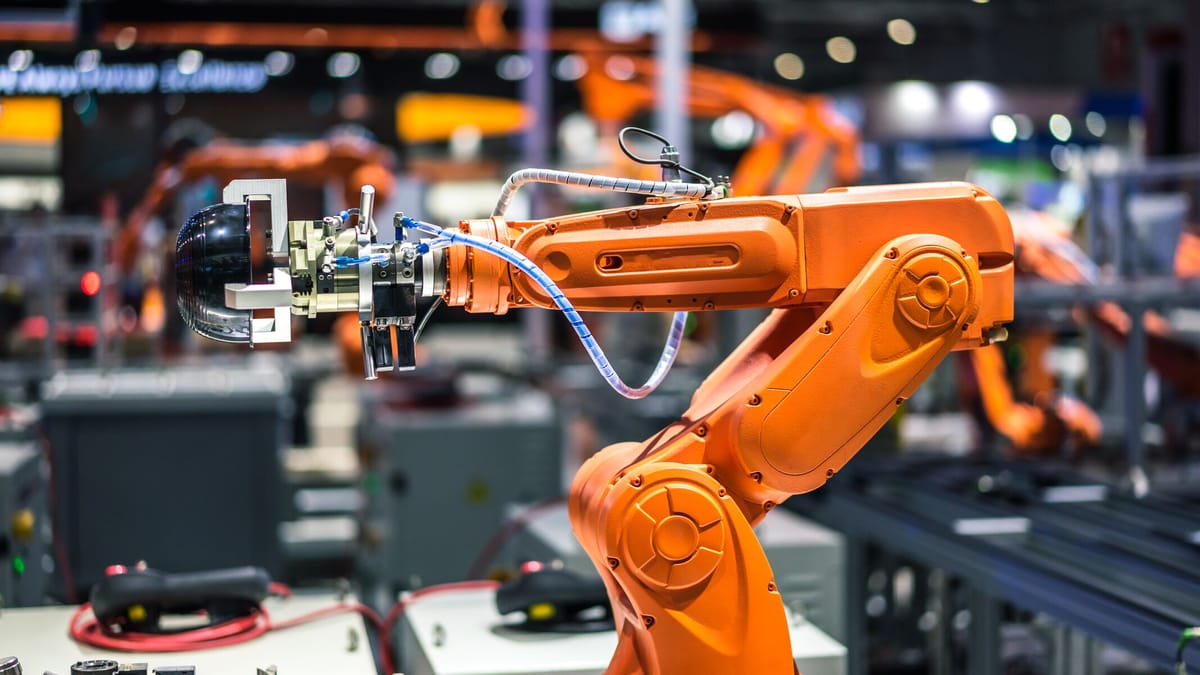Die Elektronikmaschinenbauer zählen zu den sensibelsten Seismografen der Industrie. Wo ihre Auftragsbücher anschwellen, rollen bald Investitionen an. Wo sie einbrechen, kündigen sich größere Probleme an. Jetzt legt der VDMA zur Leitmesse Productronica neue Zahlen vor – und sie erzählen eine Geschichte zwischen vorsichtigem Aufbruch und zementierter Krise.
Zwischen Hoffnung und Ernüchterung
Knapp 20 Prozent der Unternehmen erwarten im kommenden halben Jahr bessere Geschäfte. Das ist ein bemerkenswerter Wert für eine Branche, die zuletzt tief im Klammergriff aus Investitionszurückhaltung, Lieferkettenproblemen und globaler Unsicherheit steckte. Nur zehn Prozent der Firmen rechnen mit weiter sinkenden Umsätzen.

Doch dieser Hoffnungsschimmer darf nicht täuschen: Über die Hälfte der Unternehmen beschreibt ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht oder sehr schlecht. Gerade einmal 0,5 Prozent halten sie für gut. „Sehr gut“ sagt niemand. Für eine Branche, die sonst zyklisch, aber robust ist, ist das ein historischer Tiefpunkt.
Rund 20 Prozent der Unternehmen stellen für 2026 ein Umsatzwachstum zwischen zehn und fünfzehn Prozent in Aussicht. Das klingt kräftig – ist aber im Kontext der Einbrüche der vergangenen Jahre kaum mehr als eine Reparaturbewegung.
Wo es bergauf geht – und wo nicht
Entscheidend ist, wer die Kunden sind.
Wer für die Autoindustrie produziert, blickt massiv düsterer in die Zukunft als der Rest. Die Absatzprobleme großer Hersteller, die verschobenen Investitionen in Elektromobilität und die Kriegskassen der OEMs, die vielerorts leerer werden, schlagen unmittelbar durch. Viele Maschinenbauer mit Automotive-Schwerpunkt verzeichnen verschleppte Projekte und stillstehende Investitionsprogramme – und das seit Monaten.
Ganz anders sieht es im globalen Elektronikgeschäft aus. Die Nachfrage nach Bauteilen, Leiterplatten und elektronischen Baugruppen zieht kräftig an. Der Verband ZVEI berichtet von einem weltweiten Nachfrageanstieg, getrieben vor allem durch die USA, China und die asiatisch-pazifische Region. Europa hinkt hinterher, soll aber ebenfalls wieder Wachstum sehen – wenn auch deutlich schwächer.
Mit anderen Worten: Wer weltweit verkauft, hat Chancen. Wer am deutschen Automarkt hängt, hat Probleme.
Globale Nachfrage hilft – aber noch nicht überall
Die strukturelle Lage bleibt angespannt. Die Abhängigkeit von Schlüsselregionen wächst. Dass nahezu der gesamte Aufschwung aus Übersee kommt, zeigt, wie ausgedünnt der europäische Elektronikstandort inzwischen ist.
Der ZVEI verweist darauf, dass Nordamerika und Asien die Nachfrage treiben – Faktoren wie KI-Hardware, Rechenzentren, neue Chipfertigungen und der globale Wettbewerb um technologische Souveränität wirken wie Investitionsmotoren. Europa bleibt dagegen der Kontinent der zaghaften Erholung: stabiler, aber weit von Dynamik entfernt.
Ein Wendepunkt? Vielleicht. Ein Aufschwung? Noch nicht.
Die neuen Zahlen zeichnen das Bild einer Branche, die vorsichtig aufatmet, aber noch lange nicht durch ist. Die Stimmung hellt sich auf, doch strukturelle Probleme verschwinden nicht.
Die Elektronikmaschinenbauer stehen zwischen globaler Sogwirkung und lokalen Bremsklötzen: Amerika und Asien treiben, Europa bremst. Wer flexibel genug ist, seine Märkte zu diversifizieren, kann profitieren. Wer weiterhin auf einen einzigen Industriezweig setzt – und sei es die prestigeträchtige Automobilindustrie –, steht vor einer unangenehmen Frage: Wie lange trägt das Geschäftsmodell noch?
Ein Aufschwung ist möglich. Aber sicher ist nur, dass er nicht alle gleichzeitig erreichen wird.