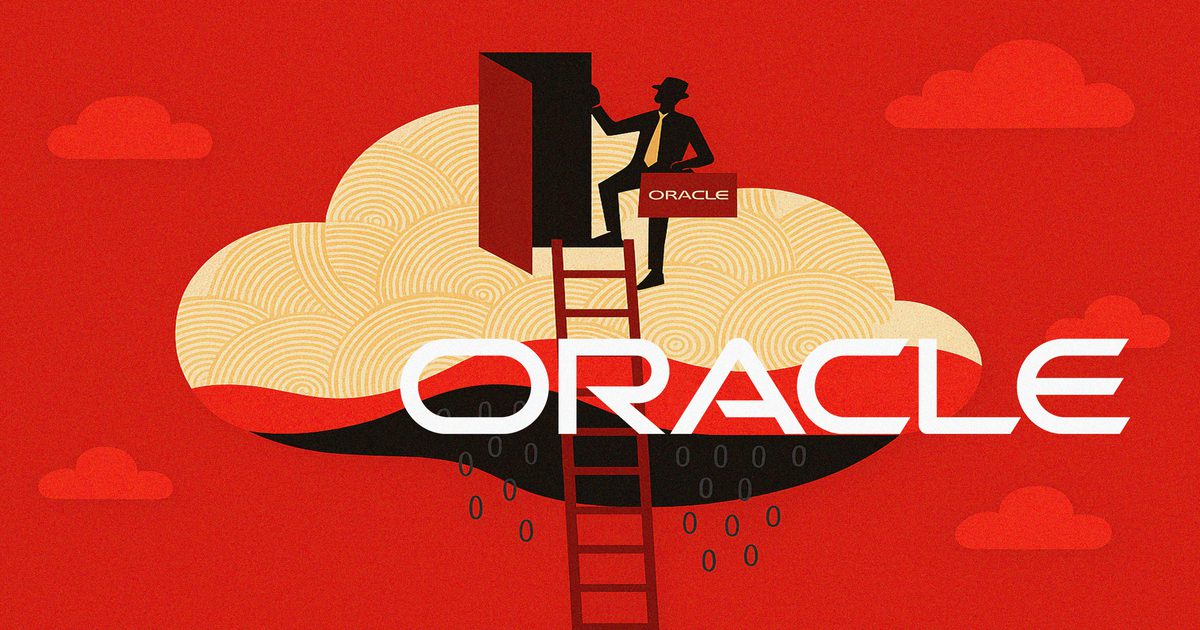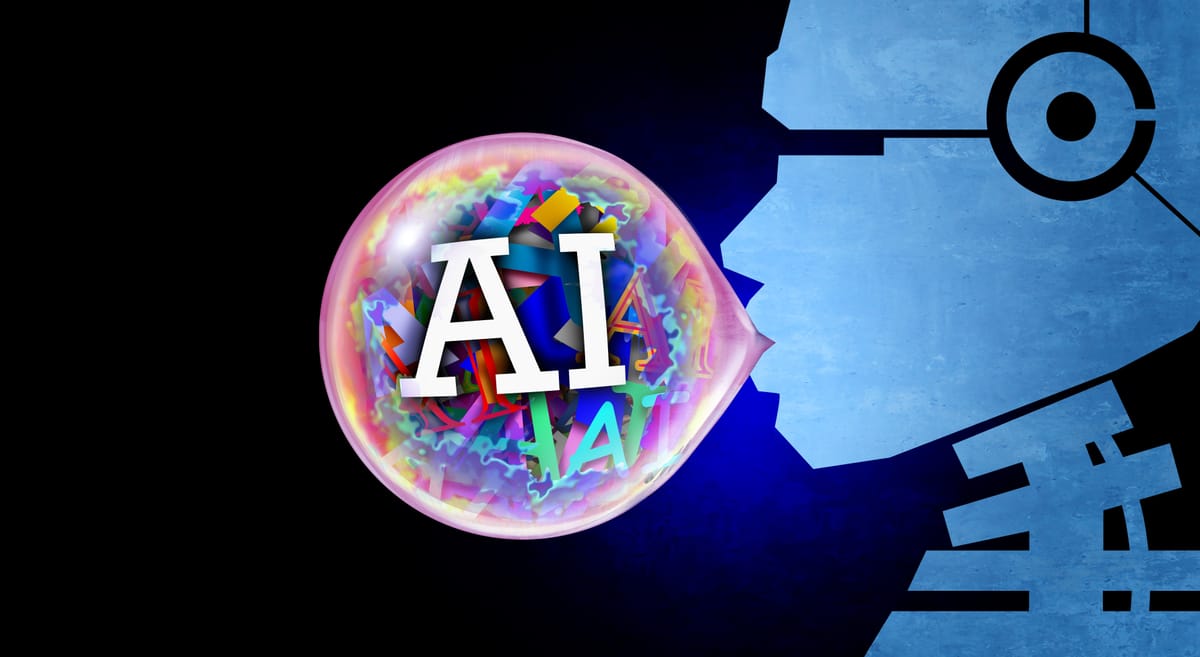Warum die 90-Milliarden-Dollar-Schuldenwelle die Euphorie bremst
Die KI-Industrie erlebt ihren größten Investitionsboom seit Jahrzehnten – und finanziert ihn zunehmend auf Pump. Amazon, Alphabet, Meta und Oracle haben seit September Unternehmensanleihen im Wert von fast 90 Milliarden Dollar ausgegeben, mehr als in den 40 Monaten zuvor. Was als Zeichen unstillbaren Kapitalhungers begann, entwickelt sich zu einem Test für die Belastbarkeit der Tech-Finanzierung. Asset-Manager warnen, dass die Märkte erstmals seit Beginn der KI-Revolution klare Risikosignale aussenden.
Die Nachfrage bleibt hoch, doch das Vertrauen bekommt Risse
Die jüngste Welle von Neuemissionen wurde vier- bis sechsmal überzeichnet. Investoren strömen weiterhin in die großen Namen, trotz gestiegener Risikoaufschläge. Für Pierre Verlé von Carmignac ist das ein ermutigendes Zeichen: Die Kapitalmärkte bleiben aufnahmefähig, selbst wenn das Volumen historisch hoch ist.
Doch die Realität im Sekundärmarkt spricht eine andere Sprache. Die Kurse frisch begebener Anleihen sinken, die Renditen steigen – und das ausgerechnet in einer Phase, in der auch die Aktien der Tech-Giganten unter Druck geraten. Der Nasdaq verliert im November mehr als sechs Prozent. Die Märkte beginnen, die Frage zu stellen, ob die KI-Investitionen wirklich so risikoarm sind, wie lange angenommen wurde.
Meta und Oracle werden zum Stresstest des KI-Booms
Während Alphabet, Amazon und Microsoft ihre KI-Investitionen aus laufenden Cashflows stemmen können, geraten Meta und Oracle stärker ins Blickfeld der Skeptiker.
Meta musste bei einer 30-Milliarden-Dollar-Emission spürbar höhere Zinsen bieten als in früheren Jahren – trotz eines Ratings von AA. Einige Anleihen gaben im Handel bereits nach. Die Interpretation liegt nahe: Anleger zweifeln nicht am Geschäftsmodell, aber an der Balance zwischen ambitionierten Zukunftsplänen und finanzieller Belastbarkeit.
Oracle steht noch exponierter da. Der Konzern will in die oberste Liga der Cloud- und KI-Anbieter vorstoßen, verbrennt aber bereits Geld und liegt nur zwei Ratingstufen über dem Ramschbereich. Analyst Jordan Chalfin erwartet zusätzliche Anleiheausgaben von bis zu 65 Milliarden Dollar innerhalb von drei Jahren. Sollte die Bonität absinken, könnte Oracle in einem Markt hängen bleiben, der schlicht nicht groß genug ist, um solche Summen zu finanzieren.
Entsprechend heftig reagiert die Börse: Die Aktie verliert im November mehr als 20 Prozent. Die Kosten für Kreditausfallversicherungen steigen – ein Vorzeichen, das viele Investoren an 2008 erinnert.

Der Boom im Rechenzentrumsbau schafft neue Risiken
Neben den etablierten Tech-Konzernen drängen neue Akteure in den Markt: ehemalige Bitcoin-Miner wie Terawulf oder Cipher Mining, die sich nun als Rechenzentrumsentwickler positionieren. Sie haben binnen weniger Wochen Hochzinsanleihen im Volumen von über sieben Milliarden Dollar auf den Markt gebracht.
Coreweave, der einzige größere KI-Cloud-Anbieter im Subinvestment-Grade-Bereich, muss Renditen von rund elf Prozent bieten – ein Niveau, das sonst nur Unternehmen kurz vor dem Zahlungsausfall zahlen. Die Aktie bricht nach Bauverzögerungen um 46 Prozent ein, liegt aber seit Börsengang dennoch über 75 Prozent im Plus. Volatilität wird hier zum Geschäftsmodell.
Für Hendrik Leber von Acatis ist das ein Warnzeichen: Die Verschuldung wachse weiter, bis ein kleinerer Anbieter scheitere. Erst danach werde sich der Markt sortieren.
Aktien und Anleihen verstärken sich gegenseitig – im Guten wie im Schlechten
Kredit- und Aktienmärkte bewegen sich derzeit im Gleichschritt. Fallen die Kurse der KI-Aktien, steigen die Risikoprämien im Anleihemarkt – und umgekehrt. John Lloyd von Janus Henderson Investors beschreibt dieses Wechselspiel als Kernproblem der Branche: Fehlt das Vertrauen an einer Stelle, kippt es an mehreren.
Für Anleiheinvestoren ist das Umfeld besonders heikel. Aktienanleger können von langfristigen Gewinnen profitieren, Bondholder dagegen nicht. Sie tragen das volle Bonitätsrisiko und erhalten im besten Fall das zurück, was sie investiert haben. Entsprechend kritisch reagieren sie auf jede Verzögerung, jeden Projektstau und jede Ratingwarnung.
Henrik Muhle von Gané sieht im gesamten KI-Sektor derzeit keinen attraktiven Punkt für Bond-Investments. Zu viel Investitionsdruck, zu wenig Kalkulierbarkeit. Lieber kurzlaufende, qualitativ hochwertige Anleihen außerhalb des KI-Sektors.
Die KI-Investitionen werden nicht stoppen – aber sie werden selektiver
Für die großen Tech-Konzerne sind steigende Finanzierungskosten kein Grund, das Tempo zu drosseln. Ihre Cashflows reichen aus, um selbst Milliardenprojekte zu schultern. John Petersen von Eyb & Wallwitz sieht in den höheren Risikoprämien keine grundlegende Verschlechterung der Bonität, sondern einen Hinweis auf die wachsende Prüfungsbereitschaft der Märkte.

Anders kann es bei kleineren Playern aussehen. Allianz-Bernstein-Experte Will Smith erwartet eine Phase der Auslese: Nur Projekte mit klarer wirtschaftlicher Logik und sauberer Kapitalstruktur werden gebaut. Andere verschwinden.
Christian Bender von Aramea Asset Management erkennt Parallelen zur Dotcom-Ära: eine Investitionswelle, die nur wenige Unternehmen unbeschadet überstehen. Entscheidend sei, wer genügend freien Cashflow generieren kann, um Investitionen in KI-Infrastruktur tatsächlich zu monetarisieren.
Die Rechenzentrum-Entwickler könnten 2026 zwischen 20 und 60 Milliarden Dollar über Hochzinsanleihen aufnehmen. Wo diese Summe genau landet, entscheidet der Kapitalmarkt – und die Geduld der Investoren.
Die Stimmung kippt, bevor die Schuldenlast sichtbar wird
Die Nervosität, die sich in Aktienkursen und steigenden Renditen zeigt, ist mehr als ein flüchtiges Stimmungsbild. Sie markiert den Übergang von Euphorie zu Prüfung. Die KI-Revolution wird nicht an den Investitionen scheitern – aber an ihrer Finanzierung könnte sie erstmals Grenzen spüren.