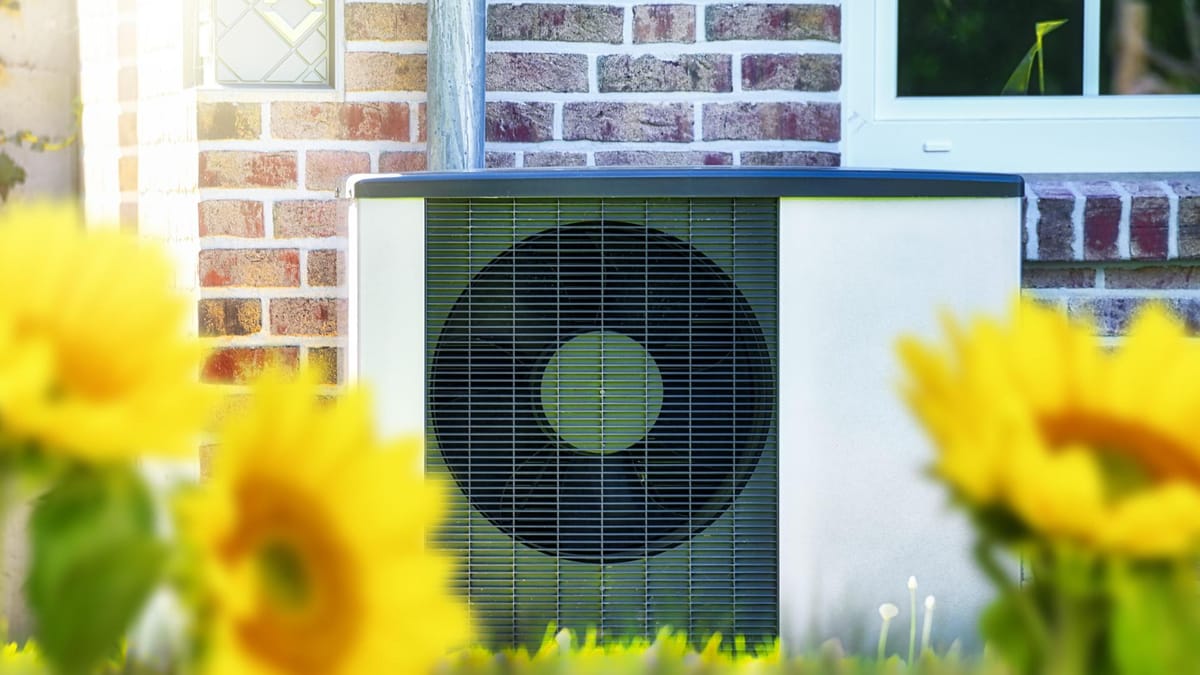Die große Reform, die keine ist
Wer darauf gehofft hat, dass das sogenannte „Heizungsgesetz“ wieder verschwindet, muss sich verabschieden. In der Immobilienbranche geht längst niemand mehr davon aus, dass der zentrale Paragraph 71 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) abgeschafft wird.
Ab Mitte 2026 dürfen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern neue Heizungen nur noch eingebaut werden, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen – zwei Jahre später gilt das auch für alle anderen Kommunen.
Was nach ambitionierter Klimapolitik klingt, hat eine unbequeme Nebenwirkung: Die Wärmewende wird zur sozialen Frage. Während die Bundesregierung an ihren Zielen festhält, können sich viele Bürger die Umsetzung schlicht nicht leisten.
Wärmepumpe oder nichts
Die Auswahl für Hausbesitzer ist überschaubar: Biomasse, Nah- oder Fernwärme oder die berühmt-berüchtigte Wärmepumpe. Wer weiterhin auf reine Gas- oder Ölheizungen setzen will, kann das nur noch in Ausnahmefällen. Und wer umbauen muss, muss tief in die Tasche greifen – Investitionen im fünfstelligen Bereich sind die Regel.

Laut KfW-Energiewendebarometer finden 83 Prozent der Deutschen die Energiewende zwar wichtig. Doch wenn es darum geht, selbst aktiv zu werden, sinkt die Bereitschaft rapide. Nur noch 59 Prozent zeigen sich bereit, in neue Technik zu investieren – der niedrigste Wert seit Beginn der Umfragen 2018.
Klimaschutz für die Oberschicht
Die Energiewende droht zur Zweiklassengesellschaft zu werden. Während 50 Prozent der einkommensstärksten Haushalte bereits mindestens eine grüne Technologie wie Photovoltaik oder Wärmepumpe nutzen, sind es bei den einkommensschwächsten nur 16 Prozent. Vor einem Jahr lag das Verhältnis noch bei 2,5 zu 1, inzwischen bei 3 zu 1.
Die Gründe sind offensichtlich: Wer wenig verdient, hat selten Rücklagen oder Zugang zu Krediten. Und wer zur Miete wohnt, hat meist überhaupt keinen Einfluss auf die Heizungsanlage. In vielen Mehrfamilienhäusern ist der Einbau einer Wärmepumpe technisch kaum machbar – und selbst wenn, entscheidet darüber der Eigentümer, nicht der Mieter.
Die große Schieflage
Die Ungleichheit zeigt sich nicht nur bei der Heizung, sondern auch bei anderen Technologien. Photovoltaikanlagen gelten als „Nummer eins“ der Energiewende – 16 Prozent der Haushalte betreiben eine solche Anlage. Fast immer sind das Eigenheimbesitzer mit ausreichend Dachfläche. Sie profitieren doppelt: durch niedrigere Stromkosten und staatliche Einspeisevergütungen.
Mieter dagegen zahlen die Umlagen mit, ohne selbst einen Vorteil zu haben. So wird aus einer Klimaschutzmaßnahme ein Umverteilungsmechanismus: Wer hat, dem wird gegeben.
Politik setzt auf „Weiter so“
Trotz wachsender Kritik hält die Bundesregierung am bisherigen Kurs fest. Eine Abschaffung der 65-Prozent-Regel ist nicht geplant. Allenfalls über Fristverlängerungen oder zusätzliche CO₂-Zielgrößen wird nachgedacht.
Die Industrie begrüßt das. Hersteller verweisen auf ungenutzte Produktionskapazitäten, Verbände drohen mit Klagen, falls die Regelung aufgeweicht wird. Doch was technisch machbar ist, ist gesellschaftlich längst nicht durchsetzbar.
Ohne neue Ideen droht das Projekt zu scheitern
Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW, warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: „Viele einkommensschwache Haushalte haben kaum Spielraum, um in die Energiewende zu investieren. Diese Gruppen müssen gezielt unterstützt werden, sonst verlieren wir den Rückhalt.“
Tatsächlich steht mehr auf dem Spiel als nur das Gelingen eines Gesetzes. Wenn Klimapolitik zum Luxusgut wird, untergräbt sie ihre eigene Legitimation. Ohne gezielte Förderung, neue Finanzierungsmodelle und technische Lösungen droht die Wärmewende zu einer Aufgabe zu werden, die nur noch eine Minderheit stemmen kann.