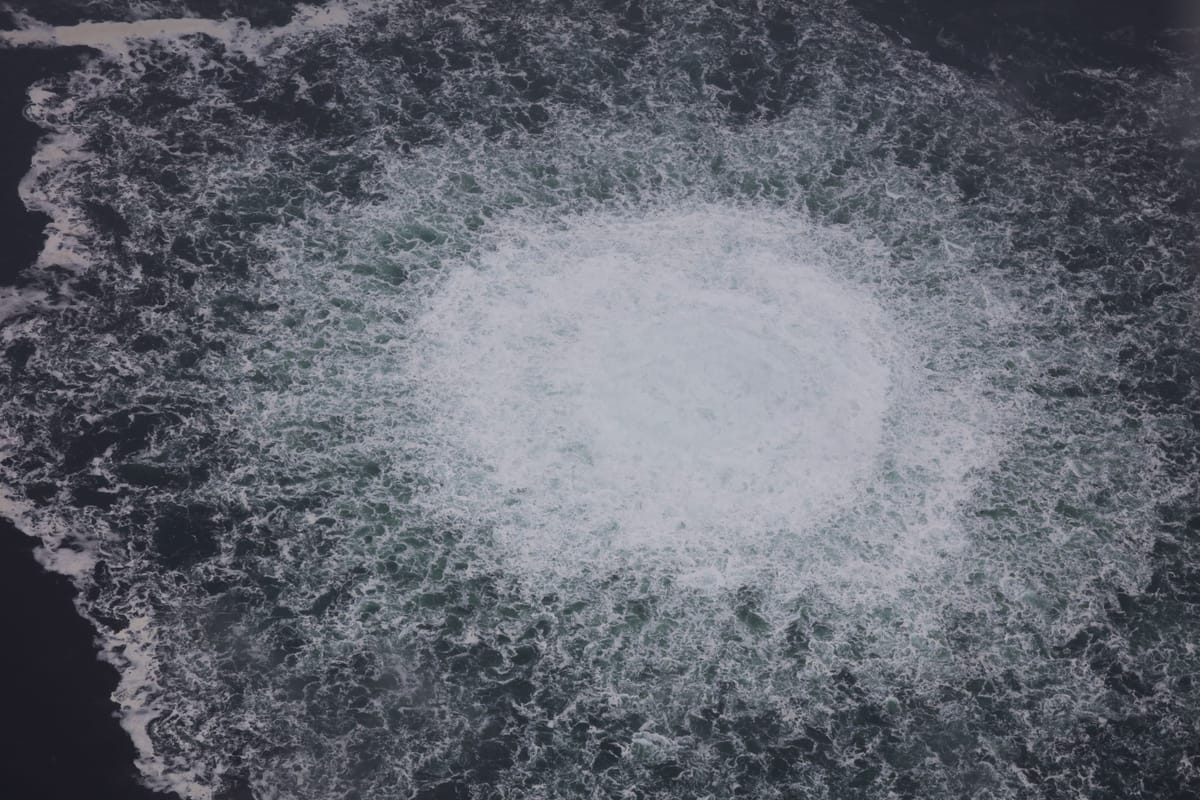Der Vorfall – und die Fragen dahinter
Es war nur ein kurzer Satz, doch seine Wirkung ist explosiv: Werbung für Edelmetalle könne – so ein interner Hinweis des BfV – im Kontext sogenannter „Crashpropheten“ zur Verbreitung rechtsextremer oder antisemitischer Narrative beitragen. Öffentlich wurde der Passus, als eine Medienanfrage an AfD-Chef Tino Chrupalla bekannt wurde. Er veröffentlichte die Anfrage auf X und fragte provokant: „Gilt Goldbesitz jetzt als rechtsextrem?“
Das Schreiben legt nahe, dass der Verfassungsschutz Einschätzungen über bestimmte Gruppen an Redaktionen übermittelt, die anschließend Grundlage journalistischer Nachfragen werden. Damit steht erneut die Frage im Raum, wie weit die Kooperation zwischen Sicherheitsbehörden und Medien reicht – und ob hier eine gefährliche Nähe entstanden ist.
Wer sind die „Crashpropheten“ – und warum interessiert sich das BfV für sie?
Als „Crashpropheten“ gelten Akteure, die seit Jahren mit Untergangsszenarien des Finanzsystems, politischer Instabilität und Währungszerfall Aufmerksamkeit erzeugen – oft flankiert von Werbung für „sichere Häfen“ wie Gold, Silber oder Krisenvorräte.
Solange es bei ökonomischen Prognosen bleibt, ist das unproblematisch. Doch dort, wo Krisenangst in Verschwörungserzählungen kippt und Feindbilder wie „die Eliten“ oder „das System“ bedient werden, beginnt der sicherheitsrelevante Teil. Das BfV sieht genau hier ein Risiko: Wenn Untergangspropaganda mit politischer Hetze verschmilzt, entsteht ein Nährboden für radikale Delegitimierung des Staates.
Dass der Geheimdienst sich für das Umfeld interessiert, ist also nicht neu – neu ist allerdings, dass ein Hinweis dieser Art öffentlich auftaucht und von Politikern instrumentalisiert werden kann.
Transparenzproblem: Wie eng dürfen Staat und Medien sein?
Der Fall wirft ein Licht auf ein grundsätzliches Dilemma: Behörden dürfen Journalisten informieren, aber sie dürfen keine vertraulichen Bewertungen selektiv weitergeben. Schon bei der Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ hatte es Diskussionen gegeben, weil Teile von Behördenunterlagen frühzeitig in Redaktionen landeten.
Chrupalla nutzt den Vorfall nun, um den Verfassungsschutz in Misskredit zu bringen. Sein Vorwurf: eine zu enge Verzahnung von Staatsschutz und Medien. Juristisch ist diese These kaum belegbar – kommunikativ aber höchst wirksam. Denn der Eindruck, der Staat bewerte selbst alltägliche Geldanlagen ideologisch, ist politisch brisant.
Zwischen Finanzkritik und Ideologie
Der Streit zeigt, wie schmal der Grat zwischen legitimer Krisenvorsorge und politischer Aufladung ist. Edelmetalle gelten in der Bevölkerung als sicherer Wertspeicher in Zeiten von Inflation und Vertrauensverlust. Wer sie bewirbt, ist nicht automatisch politisch.
Doch das BfV verweist auf ein anderes Muster: In Teilen der Szene wird der Edelmetallkauf nicht rational, sondern als Akt des Widerstands gegen „das korrupte System“ verkauft – inklusive antisemitischer Untertöne, etwa wenn von „Finanzeliten“ oder „unsichtbaren Mächten“ gesprochen wird. Genau diese Erzählungen verknüpfen wirtschaftliche Angst mit politischer Hetze.

Politische Dimension
Für die AfD ist der Fall ein gefundenes Fressen. Sie kann sich als Opfer staatlicher Überwachung inszenieren und die Debatte auf die Alltagsebene verlagern: „Darf man noch Gold besitzen?“ Damit wird ein abstrakter Sicherheitsdiskurs emotional aufgeladen – und das Misstrauen gegenüber Institutionen weiter geschürt.
Die Sicherheitsbehörden dagegen betonen, es gehe nicht um Gold, sondern um Propagandamuster, die über Finanzkanäle transportiert werden. Extremistische Gruppen finanzieren sich oft über Produkte, Abos oder Seminare, die Angst in Geld umwandeln. Wenn diese Strukturen stabilisiert werden, ist Beobachtung aus staatlicher Sicht legitim – solange sie rechtsstaatlich erfolgt.
Was jetzt zählt: Fakten statt Schlagworte
Damit die Debatte nicht vollends entgleist, braucht es drei Dinge:
- Belege statt Andeutungen – Wenn das BfV rechtsextreme Bezüge sieht, muss es diese klar benennen. Vage Formulierungen schaffen mehr Misstrauen als Aufklärung.
- Trennung von Wirtschaft und Ideologie – Goldhandel ist kein Sicherheitsrisiko. Erst die politische Aufladung macht ihn zum Gegenstand des Verfassungsschutzes.
- Transparente Kommunikation – Behörden und Medien sollten offener erklären, wie solche Bewertungen entstehen, statt sie nur bruchstückhaft durchsickern zu lassen.
Ein Streit mit Symbolkraft
Der Aufschrei um die angeblich „rechtsextreme Edelmetallwerbung“ ist weniger eine Frage des Goldes als eine über Vertrauen – in Staat, Medien und Öffentlichkeit. Wenn der Verfassungsschutz warnen will, muss er differenzieren. Wenn Politiker empört sind, sollten sie nicht skandalisieren.
Denn weder Goldkäufer noch Journalisten sind das Problem – sondern das Vakuum dazwischen, in dem Gerüchte, Misstrauen und politische Instrumentalisierung gedeihen.