Ein Austritt, der weit über Symbolik hinausgeht
Zwei Wochen Frist, dann der Bruch: Die österreichische Unternehmerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, Chefin des Wechselrichterherstellers Fronius, kündigte SolarPower Europe (SPE) die Mitgliedschaft – ausgerechnet in einem Moment, in dem die europäische Solarbranche wegen Dumping, geopolitischer Risiken und chinesischer Dominanz besonders eng zusammenrücken müsste. Aus Fronius’ Sicht war der Schritt unausweichlich. Der Verband habe verschwiegen, dass Huawei trotz laufender Korruptionsermittlungen weiterhin als „passives Mitglied“ geführt werde – mitsamt Beitragszahlungen.
Der Vorgang berührt einen Nerv, der seit Jahren blank liegt: die Frage, wie unabhängig Europas Energieinfrastruktur tatsächlich ist.

Huawei bleibt – trotz Ermittlungen und politischer Sperren
Gegen Huawei wird in mehreren EU-Staaten wegen mutmaßlicher Bestechung ermittelt. Nach Razzien in Belgien und Portugal hatte die EU-Kommission bereits im April entschieden, keine Treffen mehr mit Verbänden zu führen, die chinesische Interessen vertreten. Für Fronius war klar, dass dies den Ausschluss Huaweis aus SPE nach sich ziehen müsse.
Doch der Verband entschied anders. Zwar wurde Huawei im Sommer zunächst aus den Gremien entfernt, doch der formale Ausschlussprozess blieb aus. Im Oktober teilte SPE seinen Mitgliedern mit, dass Huawei weiterhin Mitglied bleibe – als „passives“, nicht stimmberechtigtes Mitglied. Begründung: neue Klarstellungen aus Brüssel und von Huawei selbst.
Für Fronius war genau dieser Schritt ein Vertrauensbruch. Auf kritische Nachfragen habe der Verband zu zögerlich reagiert, sagt die Firmenchefin. Dass Huawei weiterhin 60.000 Euro Jahresbeitrag zahlt und das große Verbandstreffen sponsert, verstärkte den Unmut.
Ein industriepolitisches Risiko, das sich nicht wegdiskutieren lässt
Der Streit ist kein internes Manöver, sondern Ausdruck eines tieferliegenden Problems: Chinesische Unternehmen dominieren die globale PV-Wertschöpfungskette nahezu vollständig. Bei Wechselrichtern – dem Herzstück der digitalen Netzeinspeisung – kontrolliert Huawei den weltweit größten Marktanteil, europäische Hersteller wie Fronius und SMA liegen weit zurück. In Europa stammen bereits rund 65 Prozent der gesamten Solarkapazität aus China.
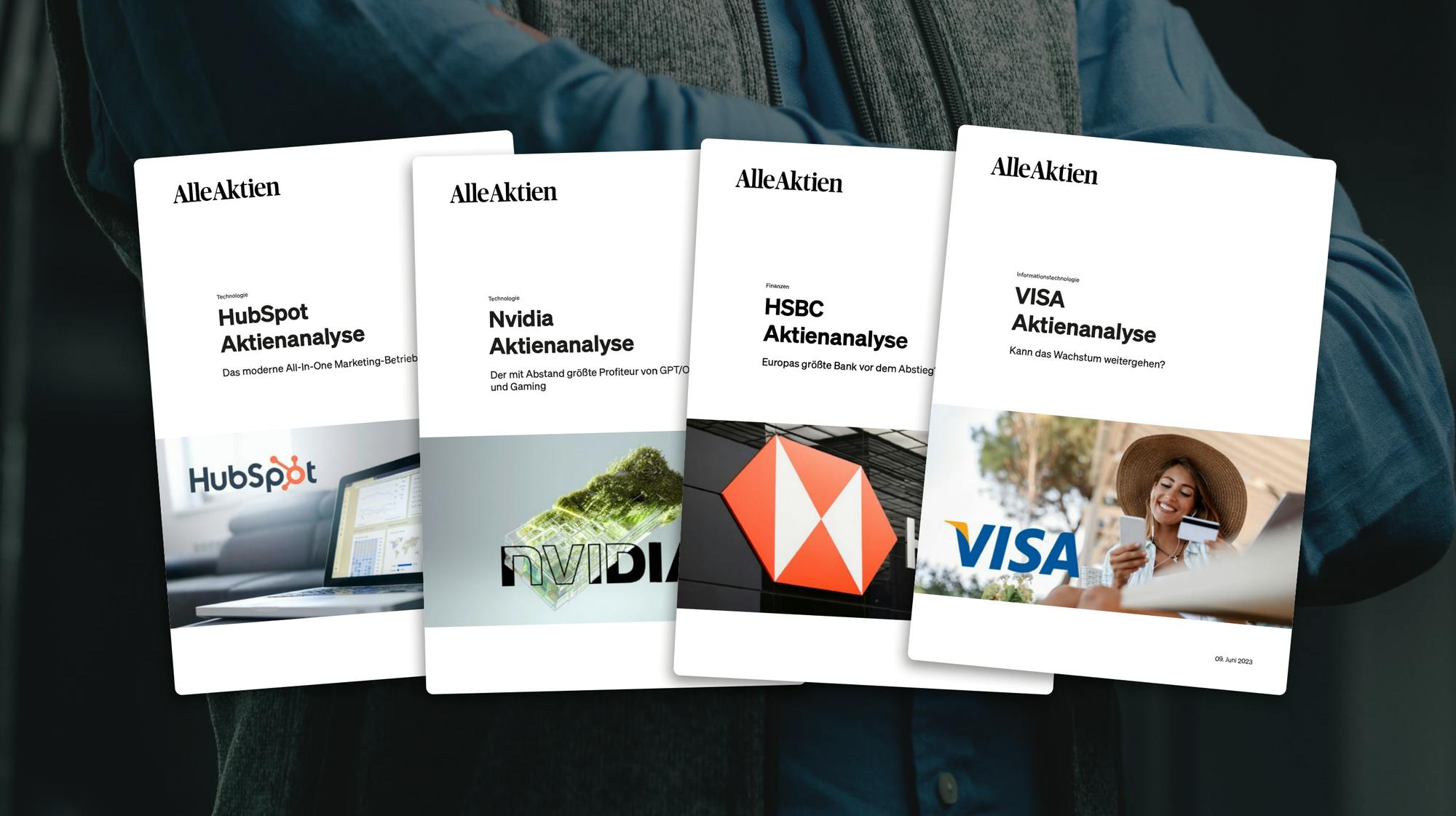
Die Warnungen europäischer Anbieter sind deutlich: Sollten chinesische Hersteller Zugriff auf genügend große Flotten intelligenter Wechselrichter haben, könnten sie theoretisch Netzfrequenzen manipulieren, Spannungsspitzen auslösen oder im Extremfall regionale Blackouts verursachen. Das Szenario ist nicht unmittelbar wahrscheinlich, aber technisch möglich – und deshalb für viele Energieexperten sicherheitspolitisch relevant.
Engelbrechtsmüller-Strauß formuliert es drastisch: Europas Stromnetz sei verwundbar, solange zentrale Komponenten aus einem geopolitischen Rivalenland stammen. Die Solarbranche sei „abhängig von chinesischer Hardware und Software“, und eine Manipulation aus der Ferne sei „technisch möglich“.
Der Verband versucht Schadensbegrenzung – doch das Vertrauen bröckelt
SolarPower Europe verweist darauf, dass Huawei als passives Mitglied keinen Zugang zu Entscheidungsstrukturen hat: weder zum Aufsichtsrat, noch zu Arbeitsgruppen, noch zu Treffen mit EU-Institutionen. Das operative Geschäft sei damit geschützt. Zudem vertrete der Verband keine Einzelinteressen, sondern nur Positionen, die im Konsens der Mitgliedschaft erarbeitet würden.
Doch genau dieser Prozess ist umstritten. Laut einem Politico-Bericht soll der Verband Risiken chinesischer Hersteller in einem zentralen Positionspapier relativiert haben – eine Einschätzung, die SPE bestreitet. Man habe lediglich die Unterstützung für ein internes Dokument bekräftigt und kein externes Papier zurückgewiesen.
Trotzdem bleibt der Eindruck: In einer Phase, in der Europa energiepolitische Souveränität zur Priorität erklärt, folgt der Verband einer Linie, die nicht alle Mitglieder mittragen.
Fronius setzt auf eine europäische Gegenallianz
Fronius will künftig ausschließlich in einem Verband mitmachen, der europäische Hersteller vertritt: dem European Solar Manufacturing Council. Dort sollen industriepolitische Interessen klar getrennt von chinesischen Marktführern verhandelt werden – mit dem Ziel, die europäische Solarproduktion und die Cybersicherheit zu stärken.
Der Schritt ist brisant, weil er einen Präzedenzfall schafft. Bisher ist Fronius der erste große Wechselrichterhersteller, der SPE verlässt. Doch in der Branche wird seit Monaten diskutiert, ob Europas Industrie durch die Dominanz chinesischer Anbieter systemisch bedroht ist. Viele Unternehmen äußern ihre Bedenken nur intern – Fronius zieht nun die öffentliche Linie.
Eine Entscheidung, die die Branche in eine neue Phase zwingt
Der Austritt ist ein Warnsignal an Politik und Industrie gleichermaßen. Er zeigt, dass Europas Solarsektor an einer strategischen Wegmarke steht: zwischen globaler Kooperation und geopolitischer Abkopplung, zwischen Kosteneffizienz und Souveränität.
Zum ersten Mal hat ein führender europäischer Hersteller öffentlich die rote Linie gezogen. Das macht den Vorgang größer als ein Lobbystreit. Er markiert den Beginn einer grundlegenden Neuordnung, in der sich entscheidet, wie unabhängig Europas Energienetze künftig wirklich sind.




