Die Sozialquote erreicht einen historischen Höchststand
41 Prozent aller staatlichen Ausgaben fließen in Deutschland in die soziale Sicherung. Damit liegt die Bundesrepublik über dem Niveau der nordischen Länder, die für ihre umfassenden Wohlfahrtsstaaten bekannt sind. Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island kommen im Schnitt auf 40 Prozent, ebenso Österreich und die Schweiz. Der EU-Durchschnitt liegt bei 39 Prozent.
Knapp die Hälfte des deutschen Sozialbudgets entfällt auf Renten. Die Debatte um das Rentensystem gewinnt damit an Brisanz: Noch bevor die nächste Reform begonnen hat, arbeiten sich die Sozialausgaben weiter nach oben. Auch die Gesundheitsausgaben – 16 Prozent der Gesamtausgaben – liegen an der Spitze Europas und belasten den Haushalt zusätzlich.
Der Staat wächst schneller als seine Aufgaben
Das IW untersucht die Entwicklung seit 2001. Der Befund ist eindeutig: Der deutsche Staat gibt mehr Geld aus als vergleichbare Länder – und er gibt es an der falschen Stelle aus. Besonders auffällig ist der Anstieg der Verwaltungsausgaben. Von 7,2 Prozent stiegen sie auf zuletzt 11 Prozent und liegen damit deutlich über den Werten anderer westeuropäischer Staaten.
Die Verwaltung wächst, während zentrale Investitionsbereiche stagnieren. Das trifft eine Volkswirtschaft, die unter Modernisierungsstau und schleppender Digitalisierung leidet, an einer empfindlichen Stelle.

Bildung rutscht ans Ende der europäischen Rangliste
Mit 9,3 Prozent seiner Gesamtausgaben bildet Deutschland das Schlusslicht bei den Bildungsbudgets. Österreich und die Schweiz investieren fast die Hälfte mehr. Auch die Benelux- und nordischen Länder liegen deutlich über dem deutschen Niveau.
Die Zahlen sind ein Hinweis darauf, dass die politische Prioritätensetzung nicht mit den strukturellen Herausforderungen Schritt hält. Der Fachkräftemangel verschärft sich, die Innovationskraft verliert an Dynamik – und dennoch bleibt Bildung finanziell unter Druck. Für eine wissensbasierte Volkswirtschaft ist das ein riskantes Ungleichgewicht.
Personal und Investitionen verlieren an Gewicht
Während die Gesamtausgaben stetig steigen, verharren die Ausgaben für staatliches Personal bei lediglich 17 Prozent. Öffentliche Investitionen lagen im Schnitt der vergangenen Jahre bei 6,2 Prozent – zu wenig, um Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaanpassung verlässlich voranzubringen.
Der internationale Vergleich macht den Rückstand sichtbar: Länder mit ähnlicher Wirtschaftsstruktur investieren konsequenter in öffentliche Zukunftsaufgaben, während Deutschland seine finanziellen Spielräume in die Gegenwartsverwaltung lenkt.
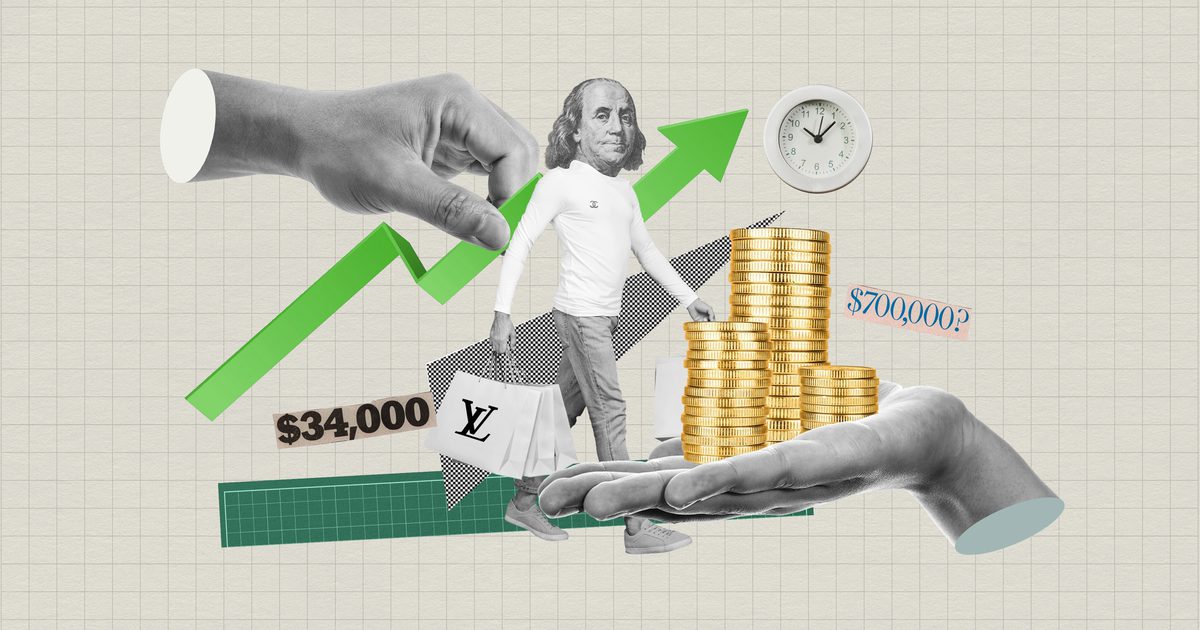
Die sicherheitspolitische Lage verändert die Haushaltslogik
Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben vor allem die nordischen Länder ihre Verteidigungsausgaben kräftig angehoben. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben stieg zuletzt auf 3,4 Prozent – und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2001. Deutschland hält dagegen konstant 2,3 Prozent.
Anders fällt der Vergleich aus, wenn man die Ausgaben auf die Wirtschaftsleistung bezieht. Beim NATO-relevanten Maß liegt kein Land der untersuchten Gruppen über der Zwei-Prozent-Schwelle. Die nordischen Staaten erreichen 1,3 bis 1,7 Prozent, Deutschland verbleibt bei 1,1 Prozent. Österreich und die Schweiz, beide außerhalb der NATO, rutschen sogar auf 0,7 Prozent.
Das IW erwartet angesichts der geopolitischen Risiken steigende Verteidigungsbudgets in ganz Europa. Für Deutschland verheißt das zusätzlichen Druck auf einen Haushalt, der bereits durch hohe Sozialausgaben gebunden ist.
Die Haushaltsstruktur entscheidet über die Zukunftsfähigkeit
Die Analyse zeigt ein Land, das immer mehr Ressourcen in laufende Verpflichtungen steckt und immer weniger Geld für die Gestaltung der Zukunft übrig hat. Der Abstand zu vergleichbaren Volkswirtschaften wächst – nicht wegen zu geringer Ausgaben, sondern wegen ihrer Verteilung. Die kommenden Haushaltsjahre werden zeigen, ob die Politik bereit ist, diese Struktur zu verändern.




