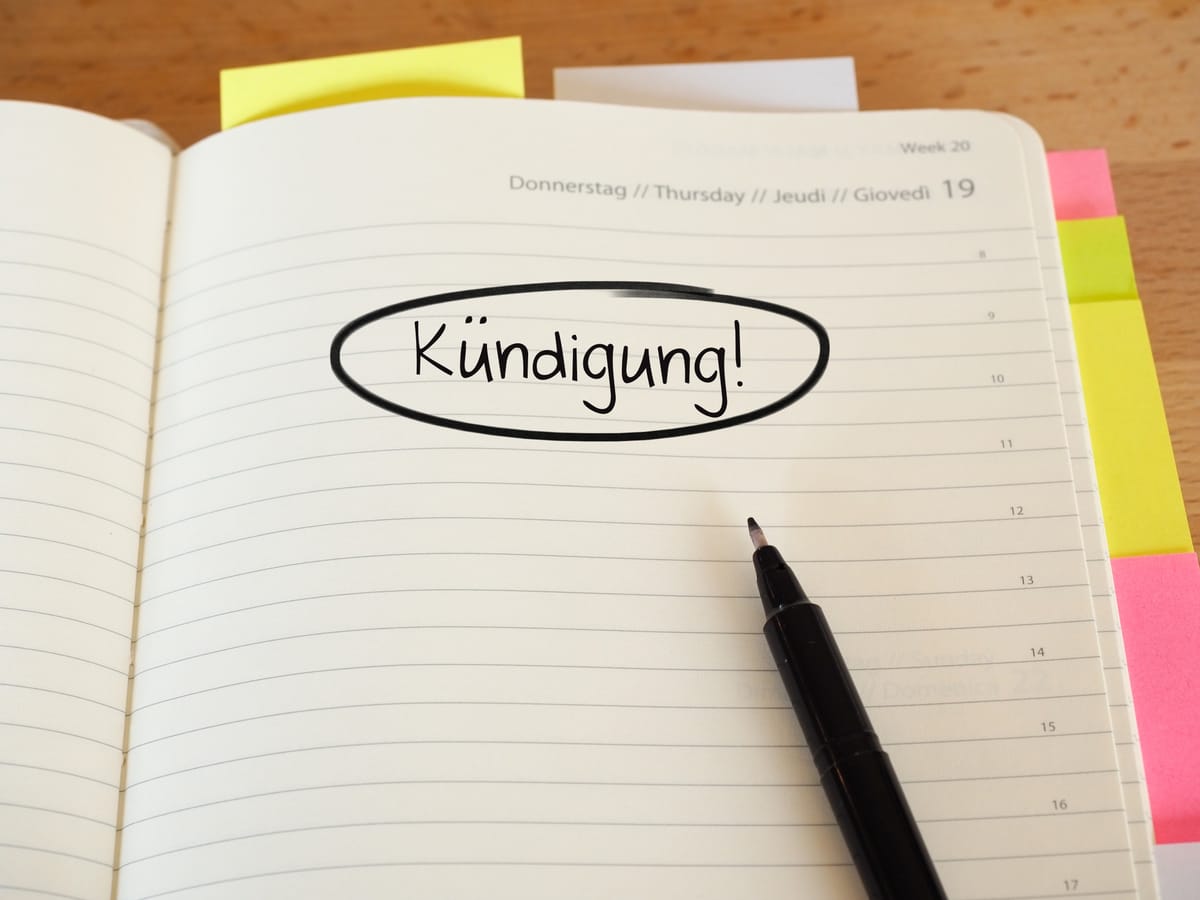Die Mehrheit erwartet keinen Durchhaltewillen bis 2029
54 Prozent der Wahlberechtigten glauben, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD die Legislaturperiode nicht überstehen wird. Nur 29 Prozent rechnen laut der Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung damit, dass das Bündnis bis 2029 hält. Der Rest ist unentschlossen.
Dieser Wert ist mehr als ein Stimmungssignal – er markiert einen zweifachen Vertrauensverlust: gegenüber der politischen Führung und gegenüber der Stabilität klassischer Koalitionsmodelle.

Auffällig ist zudem: Ausgerechnet die Anhänger der Union zeigen den größten Optimismus. 56 Prozent von ihnen glauben an das Durchhalten der Regierung. Doch in allen anderen Wählergruppen dominiert Skepsis – bei SPD-Anhängern mit 43 Prozent, bei Grünen-Wählern noch deutlicher und bei AfD-Wählern mit 78 Prozent in nahezu geschlossener Form.
Der Streit über das Rentenpaket wirkt wie ein Brandbeschleuniger
Die Umfrage fällt in eine Phase, in der die Koalition in zentralen Fragen keinen klaren Kurs findet. Das geplante Rentenpaket, von Kanzler Friedrich Merz als Kernstück der Sozialreform verkauft, sorgt in der Union selbst für Reibung. Teile der Partei halten das Vorhaben für nicht finanzierbar, andere für zu stark verwässert. Diese Unruhe überträgt sich direkt auf die öffentliche Wahrnehmung.
In der Generaldebatte des Bundestags versuchte Merz, Geschlossenheit zu demonstrieren. Er warb für schnellen Fortschritt bei den Reformen und sprach vom „neuen Konsens der Generationen“. Doch während der Kanzler die Richtung vorgibt, legt die Realität der Umfrage offen, wie wenig davon bislang bei den Bürgern ankommt.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch versucht das Gegenbild zu zeichnen: optimistisch, konstruktiv, mit dem Versprechen eines tragfähigen Kompromisses in der Rentenpolitik. Doch das politische Klima spricht derzeit gegen solche Signale. Die Koalition sendet zu selten die Einheit aus, die sie zu behaupten versucht.
Die Vertrauensfrage trifft eine Regierung ohne kräftiges Momentum
Dass die Bundesregierung bereits ein Jahr nach Amtsantritt als zerbrechlich wahrgenommen wird, hat strukturelle Gründe. Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt, Reformprojekte stocken, und die schwachen Umfragewerte der Regierungsparteien verstärken den Eindruck einer Koalition, die mehr mit sich selbst beschäftigt ist als mit der Umsetzung ihres Programms.

Vertrauen entsteht aus Kraft. Doch genau diese Kraft – politisch, wirtschaftlich, kommunikativ – fehlt der Koalition derzeit. Die Insa-Erhebung misst daher nicht nur die Stimmung der Bürger, sondern den Zustand der Regierung: fragil, unter Druck, mit wachsendem Risiko eines selbstbeschleunigten Vertrauensverlusts.
Die politische Arithmetik hat sich gegen die Koalition gedreht
Die Erwartung eines frühen Endes speist sich auch aus der veränderten Parteidynamik. Die Union kämpft an zwei Fronten: gegen interne Konflikte und gegen eine AfD, die in vielen Regionen weit stärker ist, als es einer Volkspartei lieb sein kann. Die SPD wiederum verliert in ihren klassischen Wählergruppen an Bindungskraft und findet kaum Themen, mit denen sie das Koalitionsprofil schärfen kann.
Die Koalition steht damit in einem Spannungsfeld, das jede interne Auseinandersetzung größer wirken lässt. Das Rentenpaket ist dafür nur das sichtbarste Beispiel.
Eine Regierung steht, doch das Vertrauen bröckelt schneller als die Fassade
Formal gibt es keine Hinweise auf eine baldige Auflösung der Koalition. Doch politisch wirken die Risse tiefer, als es die Regierung öffentlich eingesteht. Die Insa-Zahlen zeigen, dass viele Bürger nicht mehr an das Durchhaltevermögen der Koalition glauben – und dass dieser Zweifel zu einem beherrschenden Grundton der deutschen Politik werden könnte.
Eine Regierung kann gegen schwache Umfragewerte arbeiten. Gegen schwindendes Vertrauen wird es sehr viel schwerer.