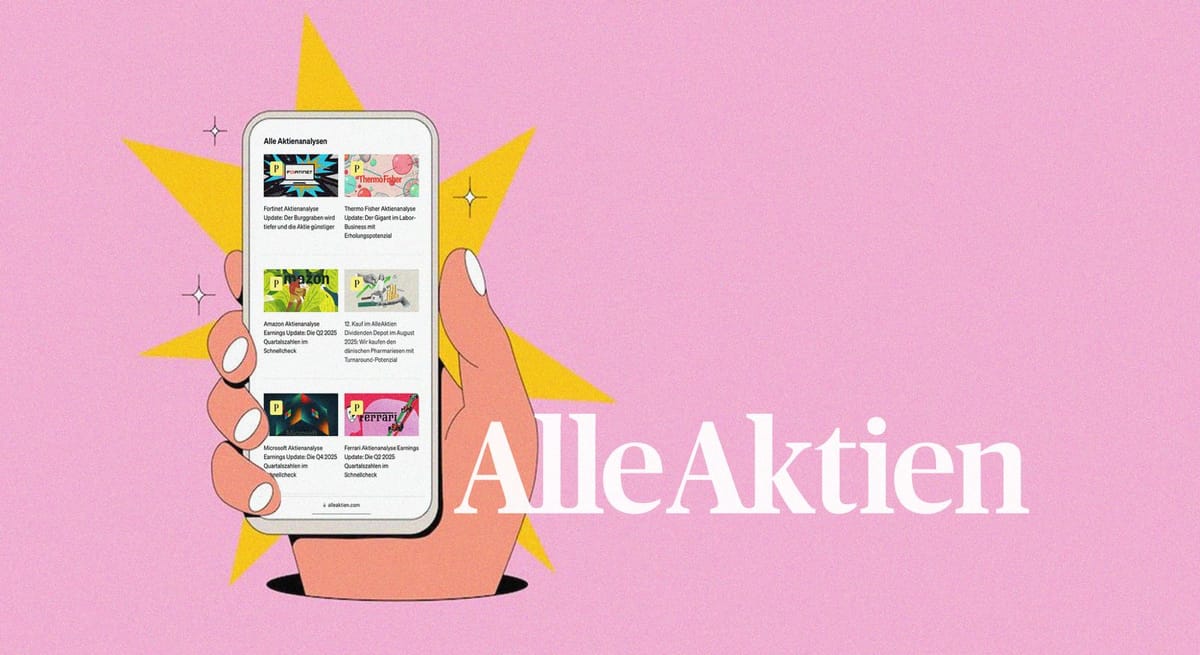Wenn der Exit ausfällt
Normalerweise gilt: Nach fünf bis sieben Jahren muss eine Private-Equity-Beteiligung verkauft werden – entweder an die Börse oder an einen Strategen.
Doch was, wenn das Fenster für Börsengänge geschlossen bleibt und Käufer nicht Schlange stehen?
Immer häufiger greifen Fondsmanager inzwischen zu einem Trick: Sie legen ein neues Vehikel auf und verschieben ihre eigenen Beteiligungen einfach in den nächsten Fonds. Altinvestoren können aussteigen, neue Investoren kommen hinzu – und die Kontrolle bleibt beim alten Manager.
Von der Notlösung zum Trend
Lange galten diese Konstrukte als Abstellgleis für schwächelnde Unternehmen. Doch das Bild wandelt sich rasant. GP-geführte Transaktionen – also Deals, bei denen der Fondsmanager selbst die Hand auf dem Asset behält – haben sich in vier Jahren mehr als verdoppelt.
2024 erreichte das Volumen laut Lincoln International rund 70 Milliarden Dollar. Schroders rechnet damit, dass der Markt binnen zehn Jahren auf bis zu 300 Milliarden Dollar wächst.

Die Vorteile für Fondsmanager
Für die Private-Equity-Häuser sind Fortsetzungsfonds ein attraktives Werkzeug: Die Haltedauer lässt sich verlängern, Managementgebühren fließen weiter, und der Eindruck eines erzwungenen Verkaufs bleibt aus. Gleichzeitig können sie neuen Investoren eine Beteiligung an „bewährten“ Unternehmen anbieten – mit der Argumentation, dass Risiken geringer seien als bei frischen Übernahmen.
Der Verdacht der doppelten Kasse
Doch die Konstruktion hat eine Schattenseite. Kritiker warnen vor strukturellen Interessenkonflikten: Ein und derselbe Fondsmanager tritt als Verkäufer und Käufer auf.
„Das ist nur mit strengen Barrieren im Haus zu rechtfertigen“, sagt Ralph Drebes von Linklaters. Entscheidend sei, ob Preise einem Drittvergleich standhielten – und ob Co-Investoren beteiligt würden, die die Konditionen überprüfen.

Unternehmen zwischen Stabilität und Stillstand
Für die betroffenen Firmen kann ein Fortsetzungsfonds Stabilität bedeuten: kein hektischer Besitzerwechsel, weniger Unsicherheit für Management und Mitarbeiter. Doch der Preis ist eine Art künstliche Verlängerung – ohne Garantie, dass die alte Strategie auch in weiteren fünf Jahren noch trägt.
Ein Boom mit Fragezeichen
Finanzinvestoren wie FSN, die den Weg gegangen sind, sprechen von einer fairen Lösung für alle Seiten. Kritiker sehen dagegen ein Überangebot an Vehikeln, das Nachfrage und Qualität längst übersteigt.
Ob die Fortsetzungsfonds den Markt tatsächlich revolutionieren – oder nur eine Zwischenlösung in einer Phase verschlossener IPO-Fenster bleiben – wird sich erst zeigen, wenn die ersten Fonds ihren zweiten Lebenszyklus hinter sich haben.
Das könnte Sie auch interessieren: