Showtime in München, Sand im Getriebe in Berlin
Als BYD-Vizechefin Stella Li die Bühne in München betritt, ist die Botschaft klar: Angriff. Mehr Modelle, mehr Markenpower, mehr Präsenz. Der Konzern, der in China binnen fünf Jahren von gut 400.000 auf 4,3 Millionen verkaufte Autos hochzog, will Europa im selben Tempo erobern.
Doch ausgerechnet in Deutschland, dem Referenzmarkt für Technik, Marke und Restwerte, verpufft die Wucht. 2024 kam BYD hierzulande auf weniger als 3.000 Neuzulassungen – weit entfernt von den einst ausgerufenen 120.000 für 2026.
Warum es in Südeuropa klappt – und hier nicht
In Italien, Spanien und Großbritannien trifft BYD auf preissensible Kundschaft, weniger Markentreue und – im Falle des UK – keine EU-Strafzölle auf China-EVs. Die Folge: chinesische Hersteller erzielen dort Marktanteile zwischen rund 7 und 9 Prozent.
In Deutschland ist die Lage anders: Käufer sind loyal, Dienstwagenfahrer restwertgetrieben, und das Preis-Leistungs-Argument allein reicht nicht. MG (SAIC) zeigt, wie’s geht: breites Händlernetz, wenige, klar positionierte Modelle – und Geduld.

Taktik mit Nebenwirkungen: Neuzulassungen und Vermieter
Über 60 Prozent der BYD-Neuzulassungen im ersten Halbjahr gingen nicht an Endkunden, sondern auf Händlerhöfe und Mietwagenflotten. Das erhöht Sichtbarkeit – kratzt aber an der Restwertstory.
Chinesische Modelle liegen ohnehin im Schnitt rund zehn Prozentpunkte unter den Platzhirschen. Wer Massen in die Kurzfristflotte drückt, riskiert künftige Leasingfaktoren und verliert Unternehmensflotten – den Schlüssel zum deutschen Markt.
Produkt-Überangebot trifft Prozess-Engpässe
Elf Modelle für Deutschland – vom City-EV bis zum Plug-in-Kombi – senden Tatendrang, überfordern aber ein noch im Aufbau befindliches Vertriebs- und Service-Ökosystem.
Händler berichten von verspäteten Lieferinfos, falsch befüllten Papieren und einem digitalen Funnel, der nicht nahtlos bis zur Bestellung führt. Ein starkes Portfolio überzeugt nur, wenn Logistik, Zulassung, Ersatzteilversorgung und Finanzierungslinien genauso präzise takten.
Die Ungarn-Karte: Lokalisieren, um zu bleiben
Das Werk in Szeged soll mit CKD-Anlauf zügig hochfahren und mittelfristig 150.000 bis 300.000 Einheiten liefern. Lokale Fertigung senkt Zolldruck, stabilisiert Lieferzeiten und verbessert die Restwertstory („Built in EU“).
Doch Montage ist nicht gleich Industrialisierung: Qualität, Lokalisierungsgrad, Zulieferintegration und Anlaufkurven entscheiden, ob Kunden BYD als europäisch verankert wahrnehmen – oder als China-Importeur mit EU-Briefkasten.
Finanzen unter Druck: China-Speed stößt an Grenzen
Zuhause wütet der Preiskampf, Überkapazitäten drücken Margen, und die Regierung pocht auf raschere Zuliefererzahlungen. Die Folge: weniger Working-Capital-Hebel, mehr Bedarf an sauberer Preissetzung und Modellmix.
Für Europa heißt das: Weg vom reinen Volumenziel, hin zu nachhaltiger Marge – sonst scheitert die Expansion an der eigenen Bilanz.

Führung im Rampenlicht: Li setzt Ziele, Davino liefert
Maria Grazia Davino soll das Händlernetz in Rekordzeit auf 100+ Standorte ausbauen und parallel die Restwert- und Flottenstory drehen. Das verlangt einen Spagat: aggressives Wachstum ohne Preisdumping, schnelle Präsenz ohne Prozessbruch, volle Showrooms ohne Überforderung der Partner. Jede Woche neue Händler-Posts sind gut – belastbare Durchläufe von Probefahrt bis Auslieferung sind besser.
Die deutsche Besonderheit: Restwerte, Flotten, Service
Der größte Hebel liegt nicht im Showcar, sondern im Zahlenwerk dahinter:
- Restwerte: Weniger taktische Zulassungen, klare Modellzyklen, professionelles Remarketing.
- Flottenfähigkeit: Total Cost of Ownership schlagen Listenpreise. Wartung, Garantie, Wertstand – alles durchgerechnet.
- Servicequalität: 48-Stunden-Teilverfügbarkeit, transparente Reparaturkosten, OTA-Stabilität – das entscheidet über Folgekäufe.
Wettbewerb kontert – und lernt schnell
Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault und Stellantis bringen die zweite EV-Welle mit besseren Plattformen, Software-Updates und günstigeren Varianten.
Parallel lokalisieren auch chinesische Wettbewerber: Chery in Barcelona, XPeng bei Magna. Die Lücke schließt sich – Differenzierung entsteht nicht mehr über den Anschlussstecker, sondern über die Gesamtleistung aus Produkt, Marke, Ökonomie und Betrieb.
Drei Szenarien bis 2027
1) „Europa-Anker“: Szeged liefert stabil, Restwerte steigen, Flotten öffnen sich – BYD erreicht >2 % Anteil in DE, nachhaltig.
2) „Volumen ohne Wert“: Hohe Zulassungen via Vermieter, schwache Restwerte – Anteil wächst, Marge erodiert, Händler murren.
3) „Stop-and-Go“: Prozesse bleiben fragil, Portfolio zu breit – teure Lernkurve, Fokus shiftet auf Südeuropa.
Was jetzt zählen wird
- Fokus statt Feuerwerk: Drei bis vier Kernmodelle mit hoher Drehzahl, klare Preisarchitektur, restriktive Taktik bei Flotten.
- EU-Industrialisation: Lokaler Content, Qualitätskorridore, Lieferzeit-SLA – sichtbar und messbar.
- Restwert-Programm: Buy-Back, garantierte RVs, remarketing-fähige Ausstattungen; Partnerschaften mit großen Leasingern.
- Händler-Enablement: DMS-Integration, schnelle Incentives, Teile-SLA, Lead-to-Delivery in Wochen, nicht Monaten.
- Markenarbeit: Weniger „China-Speed“-Rhetorik, mehr europäische Verlässlichkeit. Vertrauen schlägt Turbo.
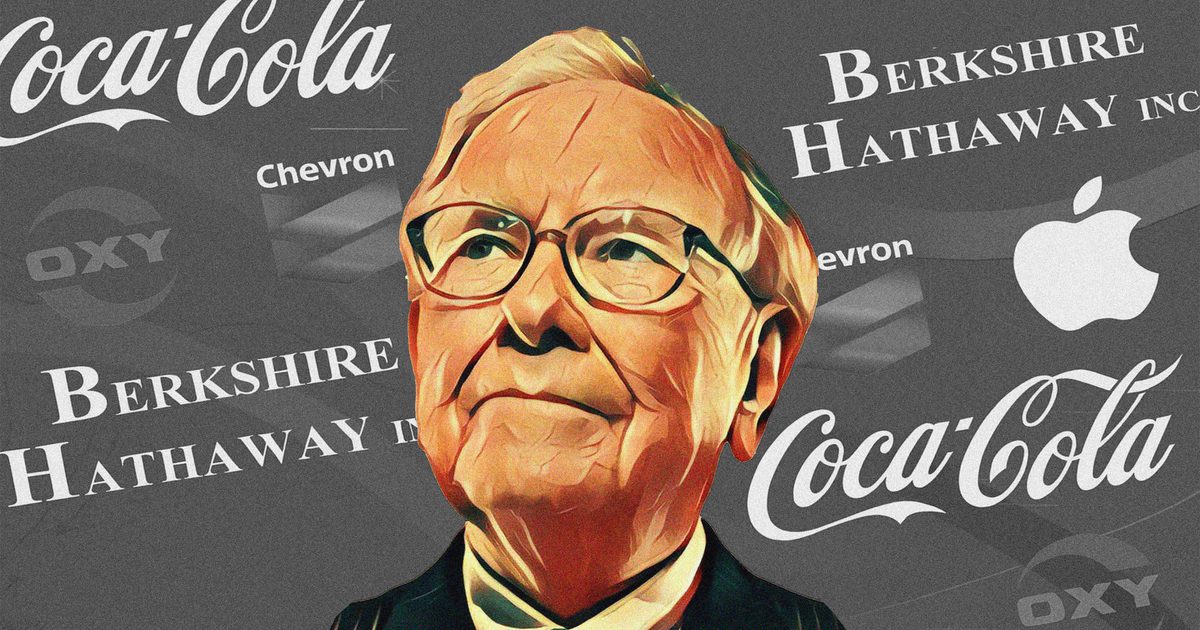
Schluss ohne Schonung
Deutschland lässt sich nicht im Sprint erobern. Wer hier gewinnen will, muss in langweilige Exzellenz investieren: Prozesse, Restwerte, Service. BYD hat die Technik, die Fabrik und den Willen.
Was fehlt, ist der deutsche Beweis: planbare Lieferketten, stabile Preise, starke Wiederverkaufswerte. Gelingt das, kippt die letzte Bastion. Gelingt es nicht, bleibt BYD die beeindruckende Kraft – ohne Wirkung im Markt, der am schwersten zu knacken ist.


