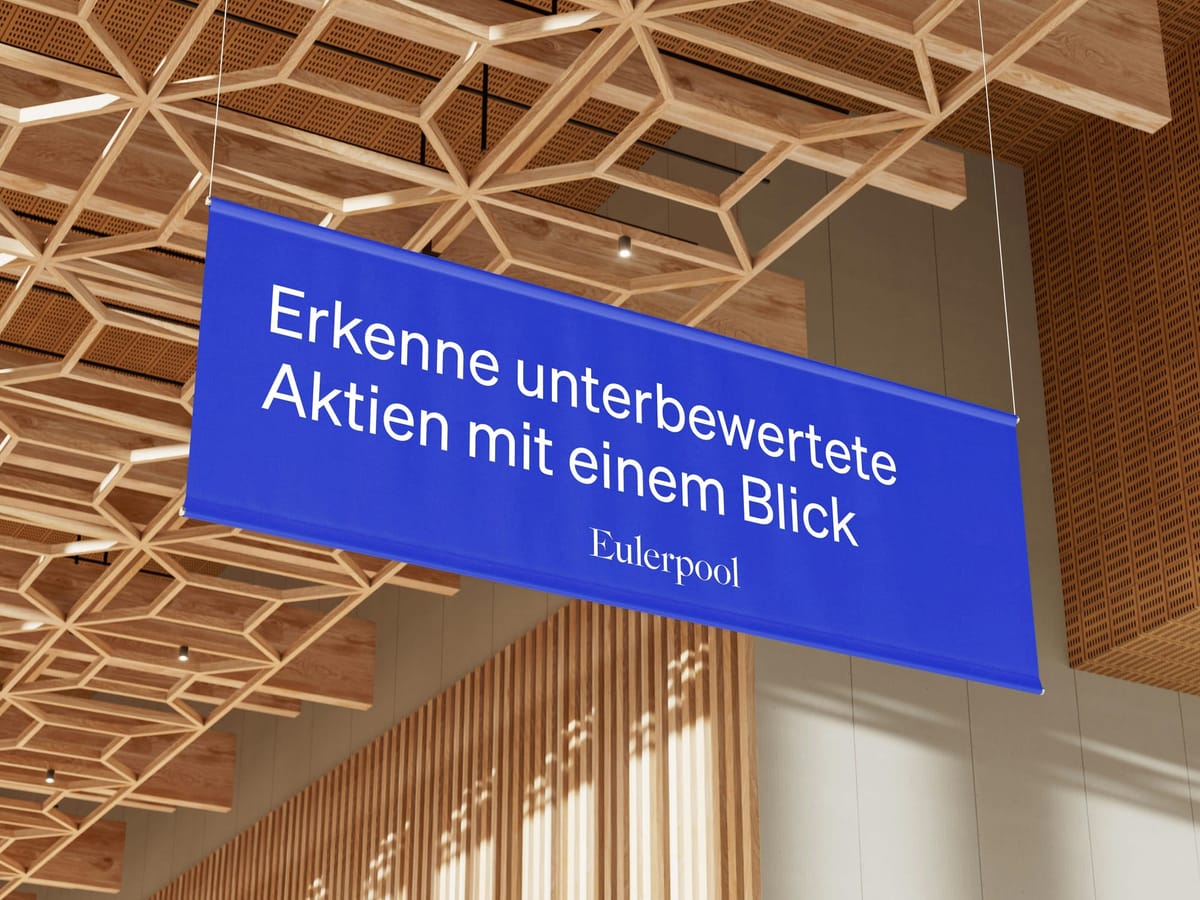Bundeswehr ordert – Airbus fährt hoch
Airbus hat, was die deutsche Rüstungsindustrie lange vermisst hat: volle Auftragsbücher. Noch in dieser Woche soll der Konzern den Zuschlag für 20 neue Eurofighter erhalten, Gesamtvolumen: rund 3,75 Milliarden Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat das Paket bereits abgesegnet – inklusive Ersatzteilen und Simulatoren.
Damit reagiert Berlin auf die sicherheitspolitische Zeitenwende, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch die Beschaffungspolitik verändert hat. Der Konzern mit Sitz in Manching bei Ingolstadt will die Produktion jetzt verdoppeln. Statt zehn Maschinen pro Jahr sollen künftig 20 vom Band laufen.
„Wir haben in den letzten Jahren gekämpft, überhaupt zweistellige Stückzahlen zu halten“, sagte Airbus-Manager Michael Schöllhorn. „Nun können wir endlich wieder hochfahren.“
Ende der Dürrejahre
Für die Zulieferer ist die Entscheidung eine Erleichterung. Unter zehn Flugzeugen jährlich lohnte sich die Produktion vieler Bauteile kaum noch – ein strukturelles Risiko für den gesamten Standort Deutschland. Der neue Auftrag stabilisiert nun die Lieferketten und sichert Tausende Jobs, allein in Manching arbeiten rund 6.000 Menschen an militärischen und zivilen Projekten.
Mit der Verdoppelung der Produktion endet eine jahrelange Hängepartie. Lange Zeit hatte die Bundesregierung bei neuen Eurofighter-Bestellungen gezögert, Exportanfragen abgelehnt und lieber auf amerikanische Konkurrenz gesetzt.
F-35 statt Eurofighter – eine alte Wunde
Als Deutschland 2022 rund drei Dutzend F-35-Tarnkappenjets von Lockheed Martin orderte, war das für Airbus ein politischer Schlag ins Kontor. Die F-35 ist das Symbol amerikanischer Rüstungstechnik – unauffällig, vernetzt, atomwaffenfähig. Sie ersetzt die alternden Tornados, die bisher als Träger für die in Büchel stationierten US-Atombomben vorgesehen waren.
Dass der Eurofighter diese Rolle übernehmen könnte, galt zwar technisch als möglich, politisch aber als unerwünscht. Berlin wollte Washington in sicherheitspolitisch turbulenten Zeiten nicht verärgern. Nun, drei Jahre später, ist die Entscheidung von damals ein doppelter Weckruf: Die Bundeswehr braucht neue Jets – und Europa braucht eine eigenständige Industrie.
Technisch aufgerüstet – taktisch neu gedacht
Die neuen Eurofighter, die jetzt bestellt werden, sind keine Wiederauflage alter Modelle. Sie sollen leistungsfähigere Radare und Systeme zur elektronischen Kampfführung erhalten – also genau jene Fähigkeiten, die moderne Luftkriegsführung heute verlangt.
Damit rüstet sich die Luftwaffe nicht nur gegen klassische Bedrohungen, sondern auch für hybride Szenarien: Cyberangriffe, elektronische Störmaßnahmen, Drohnenschwärme. Airbus plant sogar, den Eurofighter künftig gemeinsam mit unbemannten Begleitdrohnen fliegen zu lassen – ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Future Combat Air System (FCAS).
FCAS – der Kampf um die Zukunft
Das FCAS-Projekt ist die große Vision Europas: ein neues, vernetztes Luftkampfsystem aus Jets, Drohnen und digitalen Gefechtsnetzen. Doch hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen Airbus und dem französischen Partner Dassault Aviation. Die Franzosen beanspruchen die Führungsrolle, Airbus will gleichberechtigt mitreden.
Mit dem neuen Eurofighter-Auftrag stärkt Airbus seine Verhandlungsposition. Die zusätzliche Produktion bedeutet mehr Geld, mehr Technologiekompetenz – und mehr Selbstbewusstsein. Sollte das FCAS-Projekt mit Dassault scheitern, hat Airbus längst Alternativen: eine Kooperation mit den Briten und Italienern im Global Combat Air Programme (GCAP) oder mit Saab aus Schweden, deren Gripen-Jets ein Nachfolgemodell brauchen.
Exporthoffnungen aus Riad und Ankara
Auch international gewinnt der Eurofighter wieder an Anziehungskraft. Saudi-Arabien will seine bestehende Flotte erweitern – bis zu 48 neue Maschinen sind im Gespräch. Nach langem Zögern hat Berlin grünes Licht für den Export gegeben.
Noch überraschender: Auch die Türkei zeigt Interesse an bis zu 40 Eurofightern. Jahrzehntelang setzte Ankara fast ausschließlich auf amerikanische Modelle. Dass ausgerechnet jetzt europäische Jets ins Spiel kommen, ist für Airbus ein strategischer Erfolg – und für Europa ein geopolitisches Signal.
Warum der Deal weit über die Bundeswehr hinausreicht
Die Verdopplung der Produktionsrate ist mehr als eine Reaktion auf gestiegene Nachfrage. Sie ist eine Rückkehr zur industriepolitischen Vernunft. Jahrelang hatte Deutschland den eigenen Rüstungssektor ausgebremst, während Frankreich, Italien und Großbritannien ihre Kapazitäten ausbauten.
Nun wird klar: Ohne funktionierende heimische Industrie bleibt Europa abhängig – militärisch, technologisch und wirtschaftlich. Airbus sichert mit den neuen Aufträgen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Wissen und Fertigungstiefe in Schlüsselbereichen.
Europas Rückkehr zur strategischen Autonomie
Airbus hat mit dem neuen Eurofighter-Auftrag Rückenwind – wirtschaftlich, technologisch und politisch. Der Konzern zeigt, dass europäische Rüstung wieder wettbewerbsfähig sein kann, wenn sie darf.
Während die F-35 aus den USA längst fliegt, zündet Airbus nun den Nachbrenner für Europas Antwort. Der Eurofighter bleibt das Symbol dafür, dass technologische Unabhängigkeit kein Wunschtraum ist – sondern eine Frage des politischen Willens.